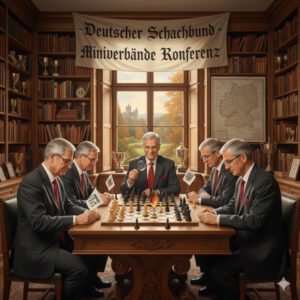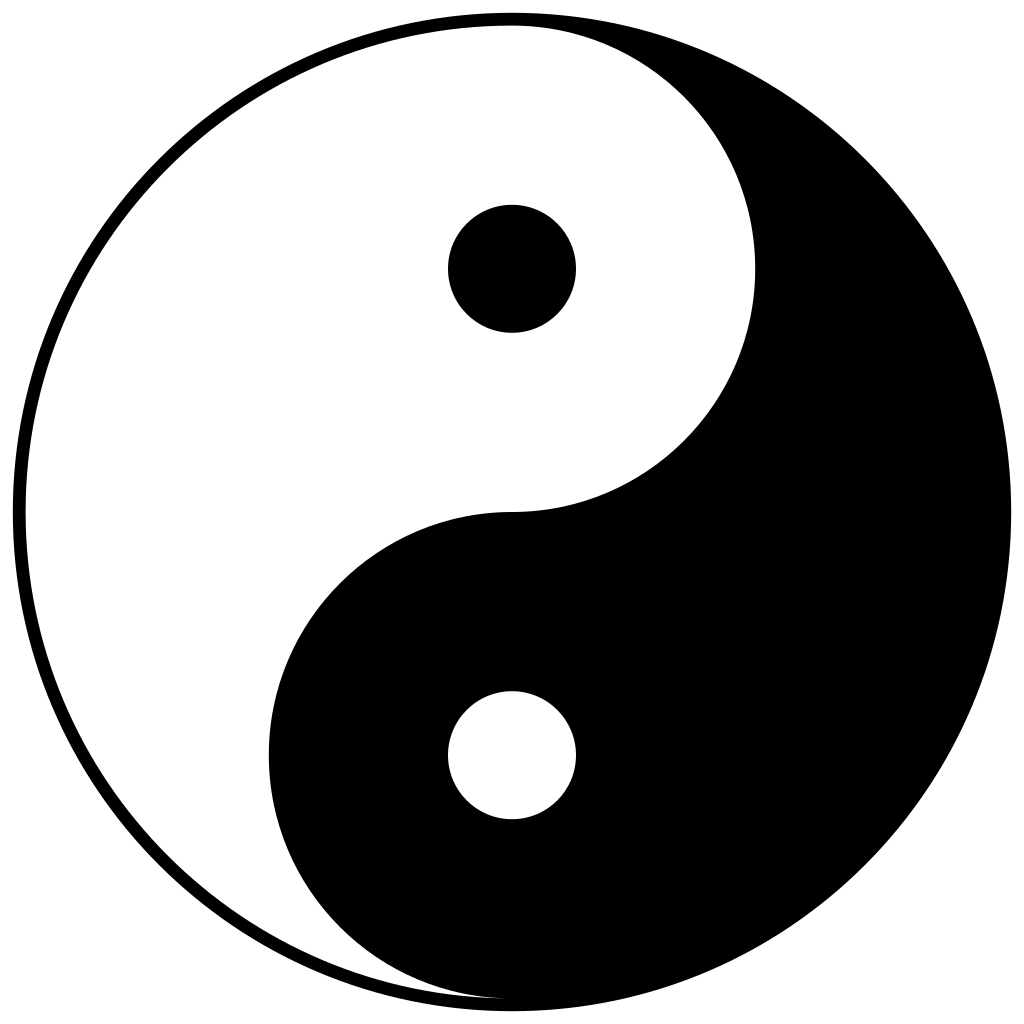
Im November 2021 veröffentlichte das IOC einen neuen Rahmen für Fairness, Inklusion und Nichtdiskriminierung auf der Grundlage von Geschlechtsidentitäts- und Geschlechtsvariationen.
Aus den Erläuterungen des IOC: „Dies folgte einem zweijährigen Konsultationsprozess mit mehr als 250 Athleten und besorgten Interessengruppen, der im Kontext wachsender Diskussionen über die besten Möglichkeiten stattfand, Transsportler und Athleten mit Geschlechtsunterschieden zu unterstützen, um im Sport auf eine Weise zu konkurrieren, die ihre Identität und ihr Wohlbefinden bestätigt und gleichzeitig sinnvolle und faire Wettbewerbe gewährleistet. Das Rahmenwerk stellt die Leitlinie des IOC zu diesem Thema für Sportverbände dar.“
Ist der Rahmen verbindlich für die Sportverbände? Nein, das IOC stellt selbst fest, dass der Rahmen unverbindlich ist. Jeder Verband bleibt für die Festlegung der Zulassungsregeln für seinen Sport verantwortlich, einschließlich der Förderkriterien, die die Qualifikation für die Olympischen Spiele bestimmen. Das IOC ist der Ansicht, dass die Sportverbände gut aufgestellt sind, um die Faktoren zu definieren, die zum Leistungsvorteil beitragen, im Kontext ihres eigenen Sports.
Trotzdem darf man davon ausgehen, dass von dem Rahmen eine gewisse Bindungswirkung ausgeht, denn im Rahmen heißt es auch unter Art. 1.5: „Wenn Sportorganisationen sich dafür entscheiden, Zulassungskriterien festzulegen, um die Teilnahmebedingungen für Männer- und Frauenkategorien für bestimmte Wettbewerbe in organisierten Sportwettbewerben auf hohem Niveau zu bestimmen, sollten diese Kriterien in einer Weise festgelegt und angewandt werden, die die in diesem Rahmen enthaltenen Grundsätze respektiert..“
Der Rahmen umfasst 10 Artikel. Im folgenden gehen wir kurz auf die wichtigsten Punkte ein, wobei der Originaltext (von englisch auf deutsch übersetzt) jeweils blau hervorgehoben ist:
1. Inklusion
1.1 Alle Menschen sollten ungeachtet ihrer Geschlechtsidentität, ihres Geschlechtsausdrucks und/oder ihrer Geschlechtsvariationen in der Lage sein, sicher und ohne Vorurteile am Sport teilzunehmen.
2. Schadensverhütung
Das physische, psychische und mentale Wohlbefinden der Athleten sollte bei der Festlegung der Zulassungskriterien Vorrang haben.
In Art. 3 wird es nun spannend:
3. Nicht-Diskriminierung
3.1 Die Zulassungskriterien sollten fair und in einer Weise festgelegt werden, die Athleten nicht systematisch aufgrund ihrer Geschlechtsidentität, ihres Aussehens oder ihrer Geschlechtsvariationen vom Wettbewerb ausschließt.
3.2 Unter der Voraussetzung, dass sie die Zulassungskriterien erfüllen, die mit Grundsatz 4 übereinstimmen, sollten die Athleten in der Kategorie antreten dürfen, die ihrer selbstbestimmten Geschlechtsidentität am besten entspricht.
Kommentar: ab hier klingt es schon seltsam: Der Sportler sollte in der Kategorie antreten dürfen, die der selbsbestimmten Geschlechtsidentität entspricht. Also nicht seinem biologischen Geschlecht, sondern seinem sozialen Geschlecht, wie man neuerdings sagt.
Doch was passiert, wenn der Sportler dadurch einen Wettbewerbsvorteil hat? Dies regelt eben Art. 4:
4. Fairness
Wenn Sportorganisationen sich dafür entscheiden, für einen bestimmten Wettbewerb Zulassungskriterien für Männer- und Frauenkategorien aufzustellen, sollten sie dies mit dem Ziel tun:
4.1 die Gewissheit zu haben, dass kein Athlet innerhalb einer Kategorie einen unfairen und unverhältnismäßigen Wettbewerbsvorteil hat (d.h. einen Vorteil, der durch eine Veränderung des Körpers erlangt wird oder der unverhältnismäßig über andere Vorteile hinausgeht, die es bei Wettkämpfen auf Elite-Niveau gibt)
Dies ist der zentrale Satz des gesamten Rahmenwerks. Um ihn besser zu verstehen, müssen auch die vom IOC veröffentlichten Erläuterungen zu den Rahmenbedingungen herangezogen werden:
„Ein Wettbewerbsvorteil ist es, dass ein Athlet einen anderen übertreffen kann. Solche Vorteile gibt es in jedem sportlichen Wettkampf, und es gibt viele Möglichkeiten, wie ein Athlet Vorteile gegenüber seinen Konkurrenten haben kann. Zum Beispiel kann ein Athlet aufgrund verschiedener Trainingsmethoden, des Zugangs zur Sportwissenschaft oder des Aufwachsens in einem Land mit einem hochentwickelten und/oder gut ausgestatteten Sportsystem einen Wettbewerbsvorteil haben.
Es gibt viele Wettbewerbsvorteile, die in Sportwettkämpfen erlaubt sind, auch wenn sie nicht für alle Athleten gleichermaßen verfügbar sind. Zum Beispiel können einige Athleten von einer größeren finanziellen Unterstützung, dem Zugang zum Höhentraining und/oder von angeborenen körperlichen Merkmalen profitieren, die ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Die Olympischen Spiele bieten oft hervorragende Athleten mit einem klaren Vorteil gegenüber anderen, die nicht als unverhältnismäßig oder unfair eingestuft wurden.
Ein unverhältnismäßiger Vorteil ist einer, der so groß ist, dass kein anderer Athlet, der an einem Wettbewerb teilnimmt, eine vernünftige Chance auf den Sieg haben wird. Ein solcher Vorteil könnte die Integrität des Wettbewerbs untergraben. Zum Beispiel rechtfertigen durchschnittliche Unterschiede zwischen Cisgender-Frauen und Männern die Bereitstellung separater Wettbewerbskategorien.“
Zitat Ende.
Kommentar: Somit sind wir an dem Punkt angekommen, dass separate Frauen- und Männerwettbewerbe im Sport ausgetragen werden dürfen, weil die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sonst zu groß wären, und genau so verhält es sich ja auch im Schach.
Doch nun ist eben zu klären, in welcher Kategorie dann Transfrauen oder Transmänner zugelassen werden. Die Aussage dazu lautet: grundsätzlich im angegebenen Geschlecht, wenn die Transperson keinen unfairen und unverhältnismäßigen Wettbewerbsvorteil in der Kategorie hat. Doch was heißt das in der Praxis? Wir kommen noch darauf zurück.
Übrigens führt das IOC in den Erläuterungen auch aus, dass dies (derzeit) sehr wenige Fälle sind: „Trans-Athleten sind eine sehr vielfältige Bevölkerung, die nicht nur Athleten unterschiedlicher Körperformen und -größen umfasst, sondern auch sehr unterschiedliche Übergangsreisen. Derzeit sind auch Trans-Athleten im Sport auf allen Ebenen deutlich unterrepräsentiert, vor allem auf Elite-Niveau. Während bestehende Studien darauf hindeuten, dass zwischen 0,1 und 1,1% der Weltbevölkerung transgender sind, identifizieren sich weniger als 0,001 % der jüngsten Olympioniken offen als trans- und/oder nicht-binär.“
Aber man muss dazu ganz klar sagen: mit steigender Tendenz, insofern ist die Aussage zu relativieren!
Kehren wir zurück zum Rahmenwerk, das noch einige Überraschungen bereithält:
5. Keine Vermutung eines Vorteils
5.1 Kein Athlet sollte von der Teilnahme am Wettbewerb (vorab) ausgeschlossen werden oder im laufenden Wettbewerb ausgeschlossen werden, nur weil er einen unbestätigten, angeblichen oder vermeintlichen unfairen Wettbewerbsvorteil aufgrund seiner Geschlechtsvariationen, seiner körperlichen Erfahrung und/oder seines Transgender-Status hat.5.2 Bis zum Beweis des Gegenteils (gemäß Grundsatz 6) sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Athleten aufgrund ihrer Geschlechtsunterschiede, ihrer körperlichen Erfahrung und/oder ihres Transgender-Status einen unfairen oder unverhältnismäßigen Wettbewerbsvorteil haben.
Kommentar: der Veranstalter des Sportwettbewerbs oder der Verband muss also darlegen, dass der Transsportler nicht in einer anderen als der selbstbestimmten Kategorie zugelassen wird, weil er dadurch einen unverhältnismäßigenWettbewerbsvorteil erhält.
6. Evidenzbasierter Ansatz
6.1 Alle Beschränkungen, die sich aus den Zulassungskriterien ergeben, sollten auf soliden und von Fachleuten überprüften Forschungsergebnissen beruhen, diea) einen beständigen, unfairen, unverhältnismäßigen Leistungsvorteil und/oder ein nicht vermeidbares Risiko für die körperliche Sicherheit anderer Athleten nachweist (…)
Kommentar: Mit Forschungen ist das so eine Sache, aber zum Glück gibt es im Schach die Elozahl, die ein sehr deutlicher und zuverlässiger Gradmesser der Spielstärke, also der sportlichen Leistungsfähigkeit ist. Auch hat die FIDE bereits festgelegt, dass ein Transsportler seine Elozahl mit dem Geschlechtsübergang mitnimmt. Übrigens nicht den Titel, da es ja separate Frauen- und Männertitel gibt.
Nur fragt man sich unwillkürlich, ab welcher Elozahl soll eine Beschränkung gelten? Ab wann ist der Vorteil unverhältnismäßig?
Wäre es nicht besser, man würde einfach das biologische Geschlecht als Grundlage der Einstufung verwenden? An dieser Stelle kommen wir zum befremdendsten Teil des Rahmenwerks:
7. Vorrang der Gesundheit und Autonomie des Körpers
7.1 Athleten sollten niemals von einem internationalen Verband, einer Sportorganisation oder einer anderen Partei unter Druck gesetzt werden (weder durch die Teilnahmekriterien noch auf andere Weise), sich medizinisch unnötigen Verfahren oder Behandlungen zu unterziehen, um die Teilnahmekriterien zu erfüllen.
7.2 Die Kriterien zur Bestimmung der Teilnahmeberechtigung für eine Geschlechtskategorie sollten keine gynäkologischen Untersuchungen oder ähnliche Formen von invasiven körperlichen Untersuchungen beinhalten, die darauf abzielen, das Geschlecht, die Geschlechtsvariationen oder das Geschlecht eines Athleten zu bestimmen.
Kommentar: Wie bitte? Das biologische Geschlecht darf nicht untersucht werden, um eine eindeutige Zuordnung zur Kategorie zu ermöglichen! Entmachtet sich hier die Sportorganisation nicht selbst? Können so überhaupt noch faire Sportwettbewerbe durchgeführt werden? Wer hat sich denn diese Regelung ausgedacht? Dieser Artikel ist offensichtlich eine einseitige Bevorzugung von Transsportlern! Doch damit ist noch nicht Schluss:
9. Recht auf Privatsphäre
9.1 Sportorganisationen sollten bei ihren Entscheidungen über die Zulässigkeit Transparenz gewährleisten und gleichzeitig darauf hinwirken, dass die Privatsphäre von Personen, die von solchen Einschränkungen betroffen sein könnten, gewahrt bleibt
9.2 Medizinische Informationen über einen Athleten, einschließlich des Testosteronspiegels, die im Rahmen der Dopingbekämpfung oder anderweitig erhoben werden, müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen behandelt werden und dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, die dem Athleten zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Informationen mitgeteilt wurden.
Kommentar: Besonders der letzte Satz missfällt besonders: selbst wenn dem Sportler im Rahmen einer Dopingkontrolle eine Blutprobe entnommen wurde, darf diese nur dann zur Geschlechtsbestimmung genutzt werden, wenn dies dem Athleten zuvor mitgeteilt wurde. Und das Ergebnis der Untersuchung soll geheim gehalten werden.
Angesichts dieser Rahmenbedingungen reibt sich der Leser verwundert die Augen. Sollte nicht das Internationale Olympische Komitee dafür sorgen, dass es im Sport fair zugeht? Wir fassen noch einmal kurz zusammen, was in den Rahmenbedingungen festgelegt wurde:
- Über die Teilnahme an einem Sportwettkampf entscheidet nicht mehr das biologische Geschlecht, sondern das selbstbestimmte Geschlecht (Art. 3.2)
- Die Überprüfung des biologischen Geschlechts, zum Beispiel durch einen Bluttest ist grundsätzlich nicht zulässig (Art. 7.1, 7.2)
- Wird doch ein solcher Test durchgeführt, muss dies dem Athleten mitgeteilt werden, und das Ergebnis ist vertraulich zu behandeln (Art. 9)
- Wird ein Transsportler von einer Wettbewerbskategorie ausgeschlossen, so muss der Ausrichter nachweisen (Art. 5.2), dass er oder sie in dieser einen unverhältnismäßig großen Vorteil hätte (Art. 4)
- Allein der äußere Anschein, das Erscheinungsbild des Sportlers (männlicher oder weiblicher Typus) darf nicht für die Einstufung herangezogen werden.
Klingt das nicht etwas ungerecht? Wir kommen zurück auf Art. 2 des Rahmens:
2. Schadensverhütung
Das physische, psychische und mentale Wohlbefinden der Athleten sollte bei der Festlegung der Zulassungskriterien Vorrang haben
Man fragt sich unwillkürlich, wie cis-gender-Sportler sich in der Lage fühlen. Der etwas gewöhnungsbedürftige Begriff Cis-gender bezeichnet übrigens, eine Person, deren Geschlechtsidentität mit dem Geschlecht übereinstimmt, das ihr bei der Geburt zugewiesen wurde.
Nehmen wir ein konkretes Beispiel: ein eindeutig männlich aussehender Sportler spielt im Frauenturnier. Der Sportler identifiziert sich selbst als weiblich, es gibt nur ein Problem dabei: die anderen Teilnehmerinnen sind anderer Meinung. Kann es wirklich sein, dass ein Verband dies zulässt? Wie steht es dann mit dem mentalen Wohlbefinden der Athletinnen? Fühle ich mich als Frau wohl, wenn ich gegen eine männlich aussehende Gegnerin antrete? Offensichtlich nicht! Also ein Verstoß gegen Art. 2! Denn das Wohlbefinden der Transsportler darf offensichtlich keinen Vorrang vor dem Wohlbefinden der restlichen Turnierteilnehmer(innnen) haben.
Oder verhält es sich sogar so, dass der Veranstalter bzw. der Verband die Teilnahme am Frauenturnier sogar zulassen muss, weil die Transfrau einen Ausweis vorgelegt hat, wonach sie nach dem neuen Selbstbestimmungsrecht des Bundes ihr Geschlecht vom Mann zu Frau gewechselt hat?
Nein, der Verband muss dies nach den Rahmenbedingungen nur dann zulassen, wenn der Transsportler keinen unverhältnismäßig großen Vorteil durch die Teilnahme hat. Diese Entscheidung kann nach Lage der Dinge entweder anhand der aktuellen Elozahl (unverhältnismäßig hoch) oder des biologischen Geschlechts (überwiegend männlich) getroffen werden.
Oder sollte vielleicht aus Gründen der Fairness eine eigene Kategorie für Transsportler geschaffen werden? Hierzu führen die Erläuterungen des IOC folgendes aus:
Mit nur wenigen Ausnahmen basiert der olympische Sport auf binären Wettkampfkategorien, die Frauen und Männer trennen. Der Rahmen erkennt auch das Prinzip der Selbstidentifikation an, was bedeutet, dass kein Athlet in einer Kategorie antreten sollte, die nicht mit ihrer Geschlechtsidentität übereinstimmt. Der Begriff Transgender kann als Oberbegriff angesehen werden, der eine Vielfalt von Identitäten und gelebten Erfahrungen (z. B. nicht-binär und queer) umfasst. In ähnlicher Weise können sich Menschen mit Geschlechtsvariationen auf vielfältige Weise identifizieren. Die Mehrheit der Transsportler und Athleten mit Geschlechtsvariationen identifizieren sich jedoch mit dem Wunsch und dem Wunsch, in einer der beiden bestehenden binären Kategorien anzutreten. Daher wäre es nicht angebracht, Transfrauen zum Beispiel zu verpflichten, an einer dritten Kategorie teilzunehmen, wenn sie tatsächlich Frauen sind. Der Rahmen unterstützt jedoch die Verwendung von Förderkriterien, um einen sinnvollen und sicheren Wettbewerb innerhalb bestehender Kategorien zu gewährleisten.
Wie hoch ist nun die Gefahr des Missbrauchs durch Transgender-Fälle? Das IOC führt hierzu folgendes aus:
Es gibt nur wenige bis keine aufgezeichneten Fälle von Athleten, die unaufrichtig versuchen, unter einer Geschlechtsidentität anzutreten, die sich von der unterscheidet, die sie konsequent und beharrlich verwenden. Trotzdem hat der Rahmen spezifische Bestimmungen, um die Möglichkeit zu verhindern, dass Sportler Schutzmaßnahmen für Transgender-Athleten missbrauchen.
Nun ja, so dachte das IOC, und dann kam der Skandal im Boxsport bei der Olympiade 2024, der sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit abspielte. Der Boxverband hat die betroffene Athletin bereits aufgefordert, ihre Goldmedaille zurückzugeben, nachdem ein nachträglicher Bluttest XY-Chromosomen bestätigt hat.
Werfen wir abschließend einen Blick auf Verbände, die das Thema aus unserer Sicht vernünftiger geregelt haben, indem sie mehr auf sportliche Fairness setzen:
Leichtathletikverband
Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) richtet sich nach den World-Athletics-Regeln, die seit 2023 Transfrauen, die nach der Pubertät eine männliche Entwicklung durchlaufen haben, von Frauenwettkämpfen ausschließen – mit Verweis auf sportliche Fairness. Diese Regelung ist rechtlich zulässig, solange sie verhältnismäßig und nachvollziehbar ist.
Boxverband:
Nach den Regularien „Sex, Age and Weight“ von World Boxing soll anhand eines PCR-Tests das biologische Geschlecht aller Boxerinnen und Boxer bestimmt werden. Der PCR-Test ist ein Verfahren zum Nachweis genetischen Materials und kann per Nasen- oder Mundabstrich, einer Speichel- oder Blutprobe durchgeführt werden. Personen mit XY-Chromosomen sollen in der männlichen Kategorie antreten, Personen mit XX-Chromosomen in der weiblichen Kategorie. Verantwortlich für die Durchführung der Geschlechternachweise werden die Nationalverbände sein.
Begründet wird das neue Testregime mit Chancengleichheit und dem Schutz von Athletinnen. Auf Nachfrage, ob es in der Vergangenheit zu kritischen Verletzungen, verursacht durch die Teilnahme von Personen mit nicht geklärter Geschlechtsidentität gekommen sei, teilte World Boxing mit, dass ihnen kein Fall bekannt sei.
Es gibt sicher noch weitere Vorgehensweisen aus anderen Sportverbänden, auf die aus Aufwandsgründen nicht näher eingegangen werden soll.
Dies war ein sehr langer Artikel, aufgrund der Komplexität der Sachlage, und nun kommen wir endlich zum Fazit:
Die nationalen Sportverbände sind im Spannungsfeld von persönlicher Selbstbestimmung und sportlicher Fairness dazu aufgerufen, einerseits Transsportlern die Teilnahme an Sportveranstaltungen in „ihrer“ Kategorie zu ermöglichen, und andererseits Missbrauch durch den Geschlechtswechsel zu verhindern. Folgt das biologische Geschlecht dem sozialen Geschlecht, so ist der Fall unproblematisch; der Sportler spielt in der Kategorie seines bzw. ihres Geschlechts. Weicht jedoch das soziale Geschlecht vom biologischen Geschlecht ab, so sollte der Transsportler in der Kategorie spielen, die dem biologischen Geschlecht entspricht, um zu verhindern, dass er oder sie unzulässige Wettbewerbsvorteile erlangt, sofern diese in der jeweiligen Sportart bestehen. Aus unserer Sicht müsste das biologische Geschlecht vor der Zulassung durch einen Bluttest nachgewiesen werden, so wies das jetzt auch im Boxsport geregelt ist. Worum geht es im Sport in erster Linie? Um einen fairen Wettbewerb!
Abschließend sollte man festhalten, dass es solche Fälle auch bisher gegeben hat, nur in erheblich geringerem Maße. Gerade das neue Selbstbestimmungsrecht hat zu tausenden von Fällen des Wechsels des sozialen Geschlechts geführt, hierzu folgender Beitrag:
Die Ampel-Regierung hatte mit rund 4.000 Änderungsanträgen jährlich gerechnet. Unter dem alten Transsexuellengesetz, das unter anderem noch zwei psychologische Gutachten als Bestätigung der Geschlechtsdysphorie eines Menschen als Voraussetzung vorschrieb, hatte es im Durchschnitt 2.000 bis 3.000 Geschlechtsänderungen pro Jahr gegeben. Das neue Selbstbestimmungsgesetz sieht eine vereinfachte juristische Geschlechtsänderung vor, psychologische Gutachten entfallen. Einmal im Jahr können Menschen über das Standesamt ihren Geschlechtseintrag ändern lassen. Eltern können dies für ihre Kinder unter 14 Jahren ohne weitere Regularien tun, ab 14 Jahren können Minderjährige mit Zustimmung der Eltern oder ansonsten über das Familiengericht eine Personenstandsänderung vornehmen lassen. Nach Recherche des Spiegels haben die Standesämter in Deutschland bisher insgesamt rund 15.000 Anmeldungen verzeichnet. Laut Bericht vom Tagesspiegel vom April 2025 haben ein halbes Jahr nach Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes in Berlin rund 1.760 Menschen ihren Geschlechtseintrag im Pass geändert. Das ist natürlich eine sehr geringe Quote bei aktuell 3,9 Mio. Einwohnern.
Gerald Hertneck, im Juli 2025