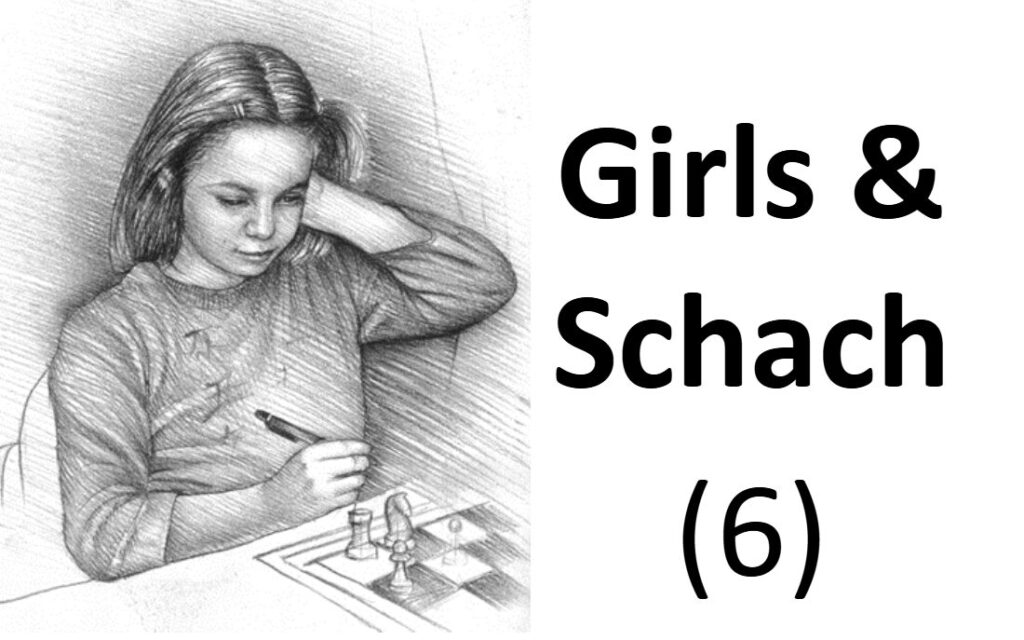
Gibt es einen Unterschied?
Eigentlich war es immer klar, dass es beim Schach einen Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt, auch wenn man zum Ziehen oder Klötzchen schieben keine Muskelkraft braucht. Die unterschiedliche Leistungsstärke, bekannt als das „Gender-Gap“, das sich mit einem Abstand von 200-300 Punkten schon in der U8 / U8w bemerkbar macht und durch alle Altersklassen zieht, ist ja ein offensichtliches Indiz dafür.
Doch plötzlich soll das nicht mehr gelten. Der Anstoß zu dieser Sinneswandlung sind die Transfrauen; Jungen oder Männer, die durch unterzeichnen eines Formulars nun als weiblich zu betrachten sind und dadurch das Recht erwerben, bei Mädchen- und Frauenturnieren mitspielen zu dürfen. Ein so gewandelter Teenager gewann die Deutsche Meisterschaft u18w, was die Besorgnis vergrößerte, in Zukunft könne auch ein Mann mit erheblicher Spielstärke nach einer solchen Wandlung in die höheren Ränge des Frauenschachs eingreifen und so den Wettbewerb verzerren. Die DSB-Präsidentin Ingrid Lauterbach positionierte sich vorschnell dazu:
„Transfrauen dürfen natürlich weiter mitspielen“, so Lauterbach: „Es gibt keine anerkannten wissenschaftlichen Studien, die ein anderes Vorgehen erlauben würden, da sind die Rahmenrichtlinien des IOC völlig klar.“
War das ein Fall von „Political Correctness“? Wollte sie eine Debatte im Keim ersticken? Sie wusste es mit Sicherheit besser.
DSB Sportdirektor Kevin Högy behauptete in einem Interview:
„Es gibt gar keinen Grund, warum Frauen schlechter Schach spielen sollten als Männer.“ Der Leistungsunterschied sei rein strukturell bedingt – nicht biologisch oder kognitiv. Die geringe Anzahl weiblicher Spitzenspielerinnen sei in erster Linie Folge ihrer zahlenmäßigen Unterrepräsentation im organisierten Schach.“
Deutschlands Spitzenspielerin Elisabeth Pähtz ist da allerdings anderer Ansicht und weist auf biologische Unterschiede hin, ebenso Hou Yifan, die aktuell beste Spielerin der Welt, die Unterschiede in der Psyche als Kernpunkt sieht. Im Interview (chess.com, 28.9.2019) äußerte sie:
„I suspect that the male perspective on chess favors men, perhaps when it comes to the emotional aspect of the game and making practical and objective decisions. To put it simplistically, I think male players tend to have a kind of overview or strategy for the whole game, rather than focusing too much attention on one part of the game.“
Ein Blick auf die Elo-Listen und die Partien im weiblichen Amateurbereich zeigen auch, wie zweifelhaft die Behauptung Högys ist.
Noch entschiedener äußerte sich ein Schachkicker-Leser in einem Kommentar:
„Frauen und Mädchen haben im Schach faktisch und wissenschaftlich belegt keinen Nachteil außer das es zu wenige von ihnen gibt – deswegen kann man auch den Vergleich mit anderen Sportarten nicht anführen. Hätten wir endlich eine Parität, bräuchten wir nicht mal mehr getrennte Wettbewerbe.“
Es ist erstaunlich, mit welchem Brustton der Überzeugung falsche und unsinnige Behauptungen aufgestellt werden. Spontan fällt mir der Spruch ein „Die Klugen sind so voller Zweifel und die …“ Okay, lassen wir das.
(Dumme Frage nebenbei: Wie erreichen wir Parität, wenn dies selbst in den ehemaligen GUS-Staaten wie etwa Georgien nicht auch nur annähernd erreicht wurde, weltweit ca. 10% der Standard ist? Was tun, wenn die Girls einfach nicht wollen? Selbst die optimistische Aktivistin Jennifer Shahade peilt nur 25-30% an.) Ein Ende von getrennten Wettbewerben wäre wohl ein schwerer Schlag fürs Frauenschach, würde zahlreiche Mädchen und Frauen dazu bewegen, kein Turnierschach mehr zu spielen.
Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Studien, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern belegen. Die mathematische Berechnung von Bilalic dagegen, die den zahlenmäßigen Unterschied als die 96%ige Ursache des Gender Gap behauptete, erwies sich dagegen als falsch und neuere Berechnung gehen von nur ca. 66% aus. Ob sich allerdings ein Problem, dem in großem Maße psychologische und soziologische Aspekte zugrunde liegen, wirklich in einem mathematischen Modell erfassen lässt, ist noch die Frage und auch eine Frage von Ursache und Wirkung.
Selbst Bilalic, der Verfechter der Gleichheit, schließt biologische Unterschiede nicht völlig aus:
„Hier wollen sie (Anmerkung: Er und sein Team) biologische Gründe hingegen nicht ausschließen: Möglich sei ‚ein Prozess der Selbstselektion auf Basis biologischer Unterschiede‘ – auch wenn diese Annahme umstritten sei, wie sie einräumen.“
(Aus SPIEGEL, „Warum Männer im Schach erfolgreicher sind“, 12.01.2009)
Eine detaillierte Übersicht zu den verschiedenen Aspekten des Problems hat GM Gerald Hertneck erstellt in seinem Beitrag:
https://schachkicker.de/wie-erklaert-sich-der-unterschiedliche-zugang-von-frauen-und-maennern-zum-schach/
Die für das Schachspiel relevanten Unterschiede zwischen Mann und Frau sind mit Sicherheit nicht monokausal, sondern auf zahlreiche sehr verschiedene Faktoren zurückzuführen. Es wird wohl nie den einen, abschließenden wissenschaftlichen Beweis geben.
Dies geht u.a. auch hervor aus der umfangreichen Untersuchung „Scientific Explanations of the Performance Gender Gap in Chess and Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)“ von Andrea Brancaccio und Fernand Gobet (Internationaler Meister und einer der weltweit führenden Schachpsychologen) im „Journal of Expertise 2023. Vol. 6(1), S.81-107.
Ein interessanter Punkt daraus ist die Bewertung von „Personality“ (S.83f.):
„Research into personality has identified a number of differences related to gender (Feingold, 1994). These differences tend to be stable across ages, time of collection, country, and educational level. Males tend to be more assertive and have slightly higher self-esteem than females. Conversely, females tend to score higher in extraversion, anxiety, and tender mindedness. On average, men tend to be more aggressive, although the pattern of aggression depends on the gender: direct aggression for men and indirect aggression for women … In general, women tend to be more risk averse than men (Byrnes et al., 1999).
Die Autoren kritisieren auch die Untersuchungsmethoden vieler Studien, die lediglich auf Datensammlungen beruhen, und kommen zu dem Schluss (Fettdruck HB):
„Conclusions
This paper has systematically reviewed the literature on gender differences in chess, showing that a gap in both performance and participation exists between men and women. Four main categories were used to group the possible explanation: statistical, based on individual differences, socio-cultural, and biological. A case is made for all the explanations, highlighting commonality, differences, and the limitations of the various approaches. The findings of this review suggests that none of these explanations can solely explain the gender differences in the field of chess.“
Tatsächlich ist derlei kein Ausnahmefall. Die Wissenschaft kann z.B. nicht schlüssig erklären, was bei der Narkose passiert. Dennoch wird sie anerkannt und erfolgreich angewandt, statt die bewährten und wissenschaftlich erklärbaren Mittel Betäubung mit Alkohol oder Holzhammermethode anzuwenden. Die Untersuchung von Brancaccio und Gobet ist ausgezeichnet und betrachtet zahlreiche Aspekte des Themas, aber natürlich schwere Kost und erfordert einige Stunden angestrengten Lesens. Leider scheinen sich viele Schachfreunde, die entschiedene Aussagen zum Thema machen, nicht der Mühe zu unterziehen, solches Material anzuschauen.
In Thomas Luther: „Hand- und Arbeitsbuch für den Schachtrainer“, Materialband, S.246; finden wir folgenden interessanten Text:
„Der Psychologe Dr. Robert Howard von der Universität Sydney untersuchte 2014 das Gender Gap im Schach speziell im Hinblick auf internationales Schach. U. a. stellte er fest, dass im Zeitraum von 1975-2014, in dem große Anstrengungen zur Förderung des Frauenschachs unternommen wurden, der Unterschied der Spielstärke dennoch mit einer Standardabweichung (=200 Elo) etwa gleichblieb. Er widerlegt auch die These, der Unterschied resultiere aus der geringeren Anzahl schachspielender Frauen. Hier ein Auszug aus seinem umfangreichen Artikel:
„Males on average may have some innate advantages in developing chess skill due to previous differing evolutionary pressures on the sexes. Females may have greater talent on average in other domains, however. If the male predominance in chess was due just to social factors it should have greatly lessened or disappeared by now. Indeed, some researchers now recognize that many psychological sex differences are due to complex interactions between nature and nurture.
This conclusion is unpalatable to many but it is best to acknowledge how the world actually is.“
Auf deutsch übersetzt:
„Männer haben im Durchschnitt einige angeborene Vorteile bei der Entwicklung von Schachfähigkeiten, was auf den unterschiedlichen evolutionären Druck zurückzuführen ist, der auf den Geschlechtern lastet. Frauen könnten jedoch in anderen Bereichen im Durchschnitt talentierter sein. Wenn die männliche Vorherrschaft im Schach nur auf soziale Faktoren zurückzuführen wäre, müsste sie inzwischen stark abgenommen haben oder verschwunden sein. In der Tat erkennen einige Forscher inzwischen an, dass viele psychologische Geschlechtsunterschiede auf komplexe Wechselwirkungen zwischen Natur und Erziehung zurückzuführen sind. Diese Schlussfolgerung ist für viele unangenehm, aber es ist das Beste, anzuerkennen, wie die Welt tatsächlich ist.“
Selbst Dr. David Smerdon, dessen Studie „Facts and Myths about Gender in Chess“ gerne von den Gleichheitsbefürwortern zitiert wird, räumt ein:
„Loads of evidence of gender differences (but not about intelligence).“
„We don’t know whether or how biological differences in the population work in chess.For example, the minority of female classical rated players are likely on the extreme end of competitiveness, preferences and comparative advantages.“
Deutsche Übersetzung:
„Jede Menge Beweise für geschlechtsspezifische Unterschiede (aber nicht für Intelligenz).“
„Wir wissen nicht, ob oder wie biologische Unterschiede in der Bevölkerung im Schach funktionieren.Zum Beispiel ist die Minderheit der klassisch eingestuften Spielerinnen wahrscheinlich am extremen Ende der Wettbewerbsfähigkeit, der Vorlieben und der komparativen Vorteile.“
Letzteres ein interessanter Punkt. Die Leistung, die einzelne herausragende Spielerinnen wie z. B. Hou Yifan erbringen (die auch ab dem 11.Lebensjahr ein spezielles Training erhielt und ähnlich wie Polgár zuhause unterrichtet wurde), kann nicht als allgemeiner Maßstab gewertet werden. Es sind positive Ausreißer.
Das sieht Judit Polgár, die stärkste Spielerin aller Zeiten, wohl anders. Sie kritisiert den mangelnden Ehrgeiz heutiger Großmeisterinnen. Viele Spielerinnen begnügten sich mit Frauenturnieren. Der Weg zur Frauen-WM sei bequem, werde oft von Eltern und Trainern vorgezeichnet – statt wirklich alles erreichen zu wollen. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung äußerte sie:
“An Frauen würden aber geringere Erwartungen gestellt, entsprechend seien sie auch schneller zufrieden und erreichten dadurch gar nicht ihr Spielstärkeplateau. An anderer Stelle brachte sie es auf diese Formel: „Zu einem Jungen könnte ein Coach sagen: Du bist so talentiert, du kannst Weltmeister werden, wie Magnus Carlsen! Zu einem Mädchen würde er sagen: Du kannst Weltmeisterin im Frauenschach werden!“
Dummerweise dürfte solches Zutrauen in die Fähigkeit des Schülers / der Schülerin noch nicht ganz zu entsprechender Spielstärkesteigerung ausreichen. Polgár hat wohl den Hang ihres Gastlandes USA zu Übertreibungen aufgegriffen.
Dass es heute keine Frau in die Top 100 schaffe, liege auch daran, dass niemand es sich wirklich vornehme. Die Titel für Frauen sieht sie kritisch: Wer für leichtere Normen dieselbe Auszeichnung bekomme, wähle eher den leichteren Weg. Polgár fordert deshalb die Abschaffung der Frauentitel. Ihre Ansicht fand einige Zustimmung.
Aber ist es wirklich so einfach? Der WGM Titel entspricht ungefähr einem Männer-FM, Elo ca. 2350, ist also keineswegs mit dem Männertitel vergleichbar. Von da aus ist es ein weiter Weg auch „nur“ zum GM-Titel, geschweige denn in die 2600-er und 2700er Ränge. Sind alle Frauen zufrieden mit Erreichen des WGM-Titels (oder bestenfalls mit dem der Weltmeisterin) und haben danach keinen weiteren Ehrgeiz mehr? Möglich in einigen Fällen, aber keineswegs der Standard. Elisabeth Pähtz z.B. hat es sicher nicht am Willen gefehlt, GM zu werden, aber sie hat sehr lange dazu gebraucht und das Ziel nur knapp erreicht. Den jungen US-Stars WGM Carissa Yip und WGM Alice Lee (15 Jahre alt) fehlt es sicher auch nicht am Willen, GM zu werden, aber wir können verfolgen, wie hoch die 2500er-Trauben hängen, ganz zu schweigen von den Normen.
Zudem ist auch die genau gegenteilige Wirkung möglich; nämlich, dass Spielerinnen, die eigentlich geneigt sind, ihre schachsportlichen Aktivitäten stark einzuschränken, sich noch eine Weile lang anstrengen, um den WIM oder gar WGM Titel als Karrierehöhepunkt zu erreichen.
Als ehemaliges Schachwunderkind hatte Polgár auch nicht die Probleme, vor denen WGMs stehen, die den GM-Titel anstreben. Neben erheblichen Kosten sind damit auch erhebliche Einschränkungen verbunden.
Ein Beispiel: Der junge Schwede Axel Smith (*1986) jagte seinem Traum, GM zu werden nach, indem er sich zwei Jahre lang (im Alter von ca. 19-22 Jahren) von der Welt in eine Hütte zurückzog und nur dem Schachtraining widmete, um von Elo 2150 auf 2458 zu klettern. Er schreibt selbst in seinem Buch „Pump up your Rating“, Glasgow 2013, S.6:
„During the past five years, I have made chess my priority over other hobbies (often), friends (more often) and school (always).
Er wurde mit 30 Jahren schließlich ein schwacher GM. Einen solchen Weg möchte verständlicherweise nicht jede Spielerin im Hinblick auf ein unsicheres Ziel hinnehmen und den damit verbundenen Opfern und Risiken hinnehmen. Den Kritikern sei gesagt: „Anderer Leute Geld und Lebenschancen opfert man gern“.
Thomas Luther hat dieses Problem in seinem Buch „Vom Schüler zum Großmeister“ als Rat an Eltern und ehrgeizige junge Spieler behandelt:
„Natürlich verdienen die Spieler der absoluten Weltklasse gut und brauchen daher auch keinen weiteren Beruf. Doch wie steht es um die, die nicht zur absoluten Spitze gehören, sondern etwas dahinter stehen? Natürlich kann man auf das Wunder eines späten Leistungssprungs hoffen – aber wie realistisch ist das in einer Zeit, wo immer mehr starke Spieler schon im Teenie-Alter ins „Geschäft“ drängen? Die Entscheidung, Schachprofi zu werden, ist in jedem Fall eine schwerwiegende mit Konsequenzen für das gesamte weitere Leben. Und sie stellt den Spieler und seine Eltern vor ein Dilemma:
Wer sein Maximum erreichen will, muss sich ganz auf Schach konzentrieren. Das beinhaltet erhebliche Abstriche oder Verzicht in der Ausbildung.
Wer die Ausbildung forciert, wird kaum zur Spitze vorstoßen können und zumindest nicht sein mögliches Maximum erreichen können.
Kompromisse führen in der Regel nur zu unbefriedigenden Ergebnissen. Mit sagen wir einer Stärke von Elo 2.500 und einem mäßigen Universitätsabschluss kann man weder im Schach noch im bürgerlichen Beruf auf eine große Karriere hoffen. Doch sind damit natürlich die Risiken minimiert. Wie so oft im Leben gilt, je höher das Risiko, desto höher mag der Gewinn sein (aber auch der Verlust). Es ist also eine Frage der persönlichen Lebensstrategie und man muss sich bei der Entscheidung den verschiedenen Möglichkeiten, Limitationen und Risiken voll bewusst sein.“
Kann man es Spielern verdenken, wenn sie (abgesehen von den Einschränkungen in ihrem persönlichen Leben) nicht bereit sind, solche Risiken einzugehen? Selbst die beste Spielerin der Welt Hou Yifan, äußerte im Interview (schachliebe.de/hou-yifan) :
„Um den absoluten Aufstieg in den Schachhimmel zu erreichen, müsste sie sich jedoch Vollzeit dem Schach widmen. Das möchte sie aber nicht, antwortet Hou Yifan im Interview, denn dann ‚wäre ich ja wie eine Schachmaschine und das will ich nicht‘. Yifan erläutert, dass es ihr wichtig sei, auch ein echtes Leben zu haben.“
Soweit für heute.
Da der Artikel sehr lang war, habe ich ihn geteilt und in wenigen Tagen folgt dann # 7 mit der Fortsetzung.
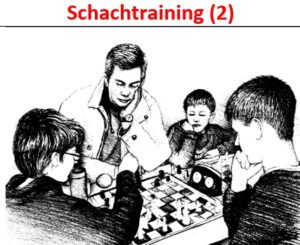
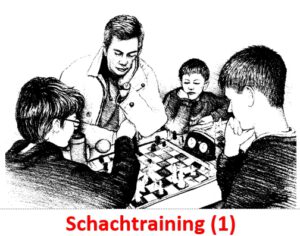
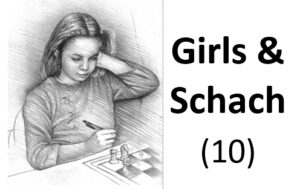
„Ist das so“?
Eine Wendung, die in einem bekannten Witz mehrfach verwendet wurde und sogar ins Gegenteil mündete.
Ich denke: „Ist das so“? stellt den Kern von wissenschaftlicher Forschung dar.
Man kann sich der Wahrheit nur annähern. Und vielleicht ist „alles anders“.
Wenn man Schachprofi werden will, muß man sicher erhebliche Abstriche machen (Susan Polgar zeigte das u.a. in ihrem Buch auf).
Ferner ist ja bekannt, daß das menschliche Gehirn mit etwa 23 Jahren beginnt, abzubauen.
Man kann also nicht sehr lange auf bestem Niveau spielen, ganz unabhängig von solchen Faktoren wie Motivation.
„Die jungen Leute lachen Dich aus“, sagte mal jemand zu mir, als ich mich über meine Performance mit 63 ärgerte.
Solche Selbstversuche wie: Wie gut kann ich denn werden?“ ist eher ein Männerding.
„Die beste Version meinerselbst erreichen“. Das wird ja oft als Argument gebracht, wenn jemand sich etwa im Bodybuilding Jahr für Jahr quält und vor sich Rechenschaft abzulegen versucht.
Ich hinterfragte auch mal vor Jahren für mich die Idee, trotz Behinderungen einen Sport wie Marathon zu betreiben. Oder etwas Vergleichbares.
Ist das gut, dieses „Trotzdem“?!
Ist ein Leben nur erfüllt, wenn man nach dem Maximum giert?
Das „Maximum“ wird einem eh irgendwann genommen, schlicht durchs Älterwerden.
Hallo Gerhard, ich schreibe aus Linz, wo ich freudestrahlend mit 3 aus 3 Punkten an der geteilten Spitze stehe. Es ist richtig, im Alter wird man nicht stärker, aber trotzdem sollte man sein bestes geben. Philosophieren wir ein wenig über das Alter. In der Staatsmeisterschaft spielen nur noch junge Spieler – das Feld hat sich so verjüngt, dass man nicht mal einen 30-Jährigen sieht. Urgestein Stanec spielt nicht, Bundestrainer David Shengelia auch nicht. Ja, es ist gerade ein Generationswechsel im Gange! Daher begrüße ich die vielen Seniorenturniere, die landauf, landab angeboten werden. Doch meist ist dort das Spielniveau und Preisgeldniveau eher bescheiden. Da muss man noch mal nachdenken, ob man nicht stattdessen doch lieber ein Open spielt. Manche spielen gern Seniorenturniere, andere weniger gern. Es ist irgendwie nicht ganz einfach mit Schach im Alter. Das sind so meine Gedanken dazu. Aber eigentlich sollte es ja hier um Schach und Frauen oder Schach und Mädchen gehen…
Ich sehe viele Spieler im Alter mind. 300 Punkte „leichter“, als sie mal waren.
Das würde ich mir nicht antun wollen.
Auch nicht, klar bessere Stellungen durch eine Unachtsamkeit zu verlieren.
Ich verfolge aber gerne Schach, das ist geblieben.
Weiterhin guten Erfolg in Linz. (Schöne Stadt!)
Bei Axel Smith muss ich an das Limburg Open 2014 denken, ich war damals als Reporter vor Ort – einmal quer durch NL von Texel nach Maastricht. Nach dem Turnier stieß ich zu einer Gruppe 15-17-jähriger, alle mit erfolgreichem Turnier, und erkundigte mich nach ihren weiteren schachlichen Plänen. Einer meinte voller Überzeugung „ich will Schachprofi werden!“, zwei andere darauf tendenziell „Bist Du verrückt, willst Du in Armut leben? Wir werden studieren und dann ein bürgerlicher Beruf, Schach als Hobby.“
Der „ehrgeizige“ Spieler wurde dann mit Mitte 20 „endlich“ GM aber erreichte nicht allzu viel jenseits von Elo 2500, wobei er weiterhin viel Schach spielt. Seinen Namen kann man vielleicht erraten oder ermitteln. Die beiden anderen wurden FM bzw. IM, sie spielen mittlerweile nur noch Mannschaftskämpfe und sind wohl jedenfalls für ein deutsches Publikum anonym.
Es gab im Turnier auch einen damals gerade 15-jährigen FM (bereits zwei IM-Normen, später 2014 die dritte und dieser Schachtitel), der hinter Erwin l’Ami Zweiter wurde und die analoge Frage „zwischendrin“ beantwortete: „Mal sehen wie ich mich weiter entwickle, noch gehe ich jedenfalls zur Schule … (lachend) naja, ich werde zu Hause unterrichtet“. Er kann wohl nun mit Schach seinen Lebensunterhalt verdienen, auch wenn er sich nicht dauerhaft oberhalb von 2700 etablieren konnte und selbst später in einem Interview sagte „ich werde kein zweiter Giri“. Einige Jahre später hieß es dabei im Pressebereich in Wijk aan Zee „so komisch es klingen mag, (er) ist bereits zu alt – wir hoffen nun auf seinen jüngeren Bruder“ [der dann auch GM wurde, spätestens jetzt sind sie nicht mehr anonym].
Es gibt ja auch Spieler, die einige Zeit viel Zeit für Schach ver(sch)wenden, Profi oder jedenfalls Halbprofi sowie IM oder GM werden und dann doch noch normal berufstätig werden. Da fallen mir einige Namen ein, die ich mal nicht nenne.