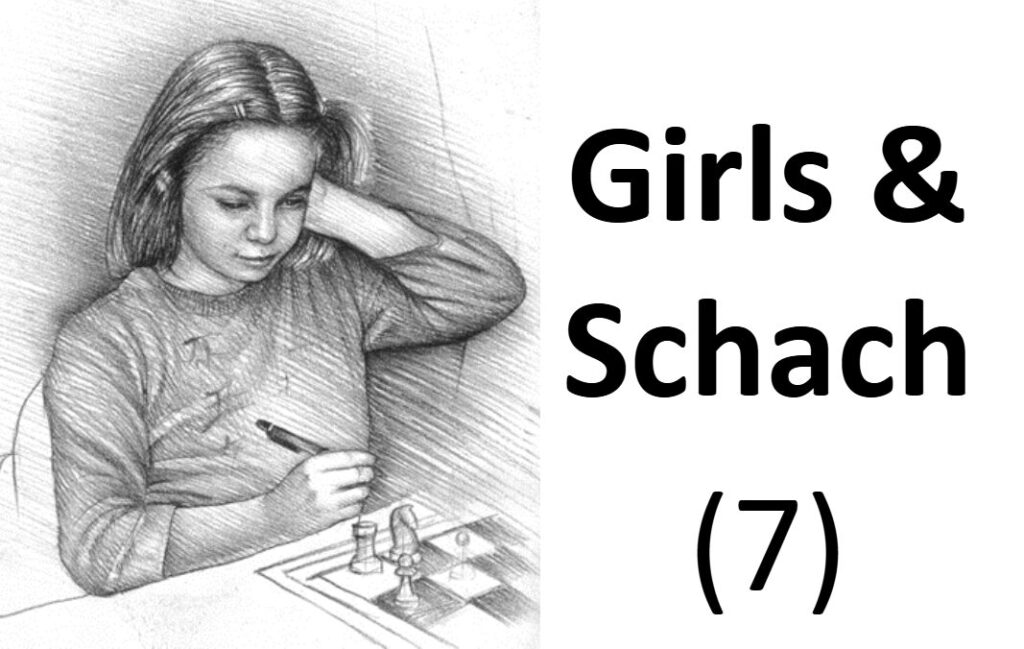
Gibt es einen Unterschied? Zweiter Teil
Es gibt ausreichend faktische Beweise für den Unterschied der Geschlechter. Ich zitiere eine Autorität unter den Schachtrainern, nämlich FIDE Lecturer und GM Adrian Mischaltschishin zur Frage „Was ist typisch für das Spiel der Mädchen“(Aus SCHACH 6/2010, S.69).
- „Gute Verwertung eines materiellen Vorteils, komplett hilflos bei der Verteidigung leicht schlechterer Stellungen, Tendenz zu passiver Verteidigung.
- Sehr schlechtes Spiel in Zeitnot und unter großem Druck.“
Auch zahlreiche andere Trainer haben auf die geringere Belastbarkeit von Frauen unter Stress im Vergleich zu Männern hingewiesen, was allgemein anerkannt wird. Dies mag auch zu geringerer Bereitschaft zu Leistungstraining über ein gewisses Maß hinaus führen, denn das ist mit enormem Stress verbunden, wie das Beispiel von Thomas Luthers Training in # 4 zeigen dürfte.
Natürlich gibt es auch Studien, die behaupten, es gäbe keinen wirklichen Unterschied zwischen den Geschlechtern und dieser würde lediglich oder zumindest überwiegend durch äußere Umstände herbeigeführt. Wir haben dies in Nr.1 gesehen mit der Studie, „Checking Gender Bias: Parents and Mentors Perceive Less Chess Potential in Girl“ der Doktorandin Sophie H. Arnold, New York University 2023.
Professor Wei Ji Ma (New York University, er ist FM), der an der Arnold Studie beteiligt war, ist selbst der Autor einer Studie, die den Unterschied der Geschlechter am Beispiel junger indischer Spieler durch ein mathematisches Modell mit der geringeren Anzahl gespielter Partien (Participation Gap) erklärte. („What Gender Gap in Chess“, ChessBase News 15.10.2020) Er muss sich aber wieder der Frage stellen, was Ursache und Wirkung ist.
Diese Studien haben fast alle eines gemeinsam: Sie gehen nicht an die Wurzel des Problems, sondern untersuchen lediglich den Bereich des organisierten Schachs. Die Frage sollte dagegen sein, was Mädchen generell vom Schach halten, was sie attraktiv finden, was sie langweilt oder sogar abstößt.
Seit Urzeiten gibt es Unterschiede in den Aufgaben der Geschlechter. Der Mann ist der Jäger und Kämpfer, die Frau die Bewahrerin. Das führt zu einem unterschiedlichen psychologischen Grundprofil entsprechend den verschiedenen Anforderungen, und betrifft u.a. den Aufwand von Energie, die Risikobereitschaft, die Rolle von Kommunikation vs. Konkurrenz. Die Schachpartie ist eine Duellsituation, eine Möglichkeit, sich zu profilieren, seinen Rang zu steigern. Das spricht Männer stark an, während Frauen ein ausgeglichenes, kommunikatives Umfeld vorziehen, das im Schach kaum existiert. Selbst die Partieanalyse ist ja ein Wettstreit der Gehirne. Niemand wird bestreiten, dass die Psychologie im Schach eine große Rolle spielt und so kann sie u. a. das Interesse am Spiel, die Faszination (intrinsische Motivation) und damit die Bereitschaft, Zeit und Energie für Spiel und Training aufzuwenden, sich ins Schach dauerhaft zu verbeißen, direkt beeinflussen. Auch Hou Yifan äußertes entsprechendes im Interview und stoppte ihre eigene Schach-Karriere, um eine akademische Ausbildung aufzunehmen, die sie mit nur 26 Jahren zu einer Professur führte.
Schauen wir uns den Beginn des Werdegangs im Schach an. Dieser hat sich in den letzten Generationen geändert. Früher war Schach ein „Vater / Opa / großer Bruder – Ding“; etwas, das man meist von einem männlichen Verwandten lernte. (Wohl auch einer der Gründe, warum Mädchen damals nur gering im Schach vertreten waren.) Seit den 1970ern mit dem Aufkommen der DSJ und dem rasanten Fortschritt des Schulschachs können wir aber annehmen, dass die Masse aller Kinder Schach in der Schule lernt bzw. erst dort beginnt, sich näher damit zu beschäftigen.
Bei kleinen Kindern ist das Interesse am Schach (Kindergarten, Grundschule) anfangs eher gleich, kindliche Neugier eben. Aber dann lässt es bei Mädchen schnell nach. In der Altersklasse u7-u14 finden wir (Stand 2024) 16.107 Jungen, aber nur 3.373 Mädchen. Das Interesse am organisierten Schach ist also an der Basis schon lediglich ca. 1 zu 5. Dies reduziert sich an der Schwelle zur nächsthöheren Altersklasse noch weiter auf fast 1 zu 7,5. (Lässt aber auch bei den Jungen um mehr als die Hälfte nach).
Wir sehen also das, bevor all die von den Vertretern der Gleichheitstheorie angeführten „Barrikaden“ / „gesellschaftlichen Stereotype“ überhaupt ins Spiel kommen können, das Problem schon vorhanden ist. Das Gender Gap zeigt sich übrigens auch bereits sehr deutlich in der u8 / u8w, die Fehlerquote und „unforced errors“ sind bei Mädchen ungleich höher.
Im Marketing Research sind die Kunden, die ein bestimmtes Produkt nicht kaufen, weitaus interessanter als die Käufer und es gilt herauszufinden, warum Erstere nicht kaufen und was eventuell getan werden kann, ihre Einstellung zu ändern.
Im Bezug auf die Vereinsaustritte wäre eine interessante Frage, wieweit Einflüsse von außen eine Rolle spielen. Was halten nicht schachspielende, außenstehende Altersgenossen (Girls ebenso wie Boys) vom Schach und von Schachspielerinnen? Werden diese für „uncool“ oder gar „nerdisch“ gehalten, mag das ihre Bindung zum Schach lockern, eine Art von Peer Pressure. Um was herauszufinden wären Einzel-Befragungen von Gruppen von Mädchen in verschiedenen Altersklassen und von Jungen im Teenage-Alter die richtige Methode, Fragebogen reichen dafür nicht aus. Da aber diese Art von empirischer Forschung (einige hundert Kids) aufwendiger ist als die üblichen Laborversuche mit kleinen Gruppen, wird sie gar nicht erst angegangen.
Sind die Zweifler am Unterschied zwischen den Geschlechtern im Schach nun überzeugt? Wer immer noch zweifelt möge bedenken, dass die Psychologie keine gesicherten, unanfechtbaren Ergebnisse liefert wie die Naturwissenschaften, sondern breiten Spielraum lässt, sie alles andere als allgemeingültig sind. Selbst wenn eine Mehrheit den Forschungsergebnissen entspricht bleibt viel Raum für abweichendes Verhalten. Wie ich zu sagen pflege: Wenn Menschen im Spiel sind ist alles ist möglich und auch das Gegenteil.
Nehmen wir das in der Studie in Nr.1 gezeigte Beispiel der durch geringere Erwartungen limitierte Unterstützung durch Eltern und Trainer. Ich habe selbst im Lauf der Jahre eine ganze Reihe von Eltern kennengelernt, die (oft zu) hohe Erwartungen hatten und ihren Töchtern jegliche Unterstützung gewährt haben. Allerdings redet da nicht jeder drüber (und erst recht nicht, wenn das erhoffte Ziel nicht erreicht wurde). Ein generelles Problem vieler Umfragen und Studien: Man kann nicht wissen, ob die Befragten / Teilnehmer stets die Wahrheit sagen, die ihnen manchmal sogar selbst nicht ganz bewusst oder auch weil unangenehm beschönigt oder verdrängt wird.
Werden also alle Mädchen und Frauen von diesen kleinteiligen Geschehnissen zurückgehalten? Müsste nicht trotz der angenommenen „Barrikaden“ von Zeit zu Zeit ein Girl / eine Frau den Ausbruch nach ganz oben schaffen?
Natürlich ist es logisch, dass man aus einer größeren Gruppe (90% Männer) mehr starke Spieler erwarten kann als aus einer deutlich kleineren (10% Frauen). Aber außer dem Sonderfall Polgár (seit langem inaktiv) steht aktuell nur Hou Yfan in der Weltrangliste über Elo 2600 (Humpy Koneru erreichte Ähnliches in der Vergangenheit). Das erscheint gegenüber den 165 Männern (aktiv / inaktiv = 207) doch sehr verwunderlich. Die Streuung von natürlichem Talent erfolgt ohnehin nach dem Zufallsprinzip und korreliert nicht unbedingt mit der Masse.
Zum Schluss noch ein Blick auf die beiden Themen, die diese Reihe – und manchen anderen Artikel – angestoßen haben; nämlich das „10.000 € Projekt“ von DSJ/DSB und die „Formular-Transfrauen“.
Mit Ersterem versucht man, mehr Mädchen für Schach zu gewinnen bzw. beim Schach zu halten.
Gleichzeitig aber senden Schachfunktionäre Signale aus, die genau das Gegenteil bewirken. So Jörg Schulz, ehemaliger Geschäftsführer der DSJ und Vorsitzender der Deutschen Schulschachstiftung (am Projekt beratend beteiligt), im Editorial von JugendSchach 4/2025, S.3:
„… was die Vereine tun müssen, können um Mädchen und Frauen zu gewinnen und vor allem zu halten.
Vor allem das Letztere ist das eigentliche Problem. Denn dadurch, dass Schach jünger geworden ist, werden auch immer mehr Mädchen an das Schach herangeführt. [Fettdruck von HB] Nur leider werden sie von der Schachorganisation auf allen Ebenen immer noch in Scharen vertrieben, da für viele ein weibliches Gesicht am Brett immer noch eine Zumutung ist.“
Paul Meyer-Dunker, Präsident des Berliner Schachverbandes und unterlegener Kandidat bei der Wahl zum DSB-Präsidenten, postete auf Schachfeld.de zu Belästigungen und sexuellen Übergriffen in Schachvereinen:
„… Die Liste könnte noch lange so weitergehen, das stellt einen kleinen Ausschnitt der Dinge dar, die mir geschildert wurden / ich beobachtet habe. Ich weiß nicht, ob irgendwann mal der ganz große Schock kommen muss, bis genug Leute im Schachsport das Thema und das Ausmaß ernst nehmen. Aber es klein zu reden und zu bagatellisieren ist angesichts der Realität echt daneben und hilft auch nicht, dass Frauen im Schachsport, die Opfer eines Übergriffes wurden sich irgendwann mal auch trauen, sich öffnen oder das am Ende sogar anzeigen.“
Im Tatort-Krimi „Zugzwang“ (ARD, ausgestrahlt 27.4.2025) wurde eine fiktive Schachspielerin gezeigt, die um die Weltmeisterschaft der Männer spielte, schachspielende Männer in Bausch und Bogen verdammte: „Die kennen seit ihrer Jugend nichts als ihre 64 Felder, diese ungefickten Idioten.“ Als Draufgabe gab es einen ebenso kriminellen wie verrückten FIDE-Präsidenten. Die meisten Sportverbände (oder ihnen nahestehende Persönlichkeiten) hätten in ähnlicher Situation wohl ein empörtes Statement abgegeben. Der DSB nahm das hin, hüllte sich in Schweigen.
Dafür unterstützte DSB-Präsidentin Ingrid Lauterbach den zweifelhaften Artikel von rbb24 (19.4.2025) „Die Dame wird häufig nur auf dem Brett respektiert“ mit einer bestätigenden Aussage, ohne den genannten Einzelfall zu kennen oder geprüft zu haben.
Ebenso nahm sie (s. Zitat in # 6, S.1) und auch andere Funktionäre vorschnell zum Thema Transfrauen Stellung, ohne die Frauenvertretung zu konsultieren und ignorierte deren Prostest.
Wenn aber Mädchen schon so sensibel reagieren, wie viele der Studien behaupten, wenn schon einige Sprüche oder Bemerkungen ihr Spiel schwächen und sie letztendlich aus dem Verein austreten lassen, wie werden sie erst recht negativ beeinflusst, wenn sie in Mädchen- oder Frauen-Turnieren gegen einen Jungen oder Mann spielen müssen, welcher noch überwiegend männliche Züge hat, biologisch immer noch ein Mann ist, vielleicht durch die Vorteile, die er gegenüber dem anderen Geschlecht hat, auch sportlich überlegen ist? Wie demotivierend wird es sein, wenn Mädchen mit Chancen auf Erfolge plötzlich solche neuen Konkurrenten vorgesetzt bekommen?
Marketing ist offensichtlich des DSB Ding nicht. Schachklubs für Mädchen attraktiv zu machen sieht ganz gewiss anders aus. Eltern werden dadurch wohl eher abgeschreckt, ihre Töchter in einen Schachklub zu schicken.
Drei Dinge rate ich dem DSB:
Erstens, ein Archiv anzulegen, in dem Material zu schachlichen Themen, insbesondere aus dem wissenschaftlichen Bereich, gesammelt und Interessenten zugänglich gemacht werden kann. Ein Start könnte die Artikelsammlung von Chess Life sein, dem Magazin der USCF (erhält jedes Mitglied des Verbandes, also Auflage ca. 100.000!), worunter sich exzellente Beiträge finden. Auch sonst sollten Publikationen aus Amerika mehr beachtet werden, u.a. die hervorragenden Arbeiten zum Kinderschach des Kanadiers Jeff Coakley.
Zweitens, einen wissenschaftlichen Beirat oder ein Komitee anzugliedern, von dem der DSB Beratung in wissenschaftlichen Fragen erhalten oder dessen Mitglieder mit Unterstützung des DSB Projekte erarbeiten bzw. zu solchen angeregt werden können.
Drittens, sich Beratung in Sachen Marketing ins Haus holen. Ohne eine wirkliche und fachlich fundierte Strategie wird der DSB nicht vorwärtskommen, sich nicht dauerhaft gegen professionell geführte Konkurrenten wie den Online-Plattformen behaupten können.
Und, als Unterpunkt dazu, zu überlegen, wie man mehr für die Amateure, also die breite Masse der Mitglieder, tun kann. Der DSB hat erst das Aushängeschild Bundesliga, dann die Schachjugend verloren und die Senioren sind offenbar auch nicht glücklich mit der aktuellen Lage. Der Schwerpunkt der schachlichen OTB-Aktivitäten sind heute die unzähligen privat organisierten Open-Turniere, die Spielgelegenheit außerhalb der Verbände bieten. Einen weiteren Bedeutungsverlust sollte der DSB tunlichst vermeiden.
Ein weiterer Bereich mit mangelnder Präsenz des DSB ist das Behindertenschach. Eine riesige Zielgruppe, die sich jährlich durch meist altersbedingte Erkrankungen oder tragischerweise durch Unfälle vermehrt. Der DSB sollte sich stärker mit dem sozialen Bereich beschäftigen, was eine dankbare und lohnende Aufgabe wäre.
Es gibt eine Unzahl von Wissenschaftlern und Managern, die Klubspieler sind oder waren und noch viel mehr Schachfans selbst unter denen, die nie oder nur im Schulschach organisiert waren. Der DSB muss seine „Wagenburg-Mentalität“ mit regelbeförderten Funktionären aufgeben und sich frischem Input von außen stellen. Mit dem Image des Schachspiels (aber nicht dem seiner Organisation) gibt es viele Möglichkeiten, auch mit begrenzten Mitteln viel zu erreichen. Aber ohne sich zu öffnen bleibt diese breite Tür leider verschlossen und das wäre sehr schade.
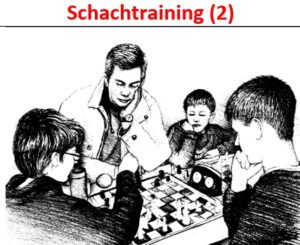
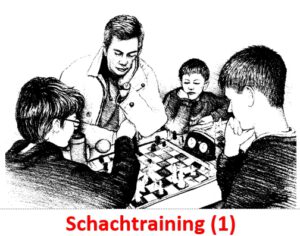
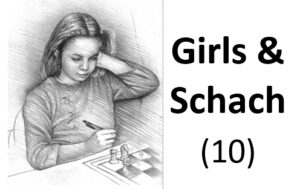
Gutes Essay!