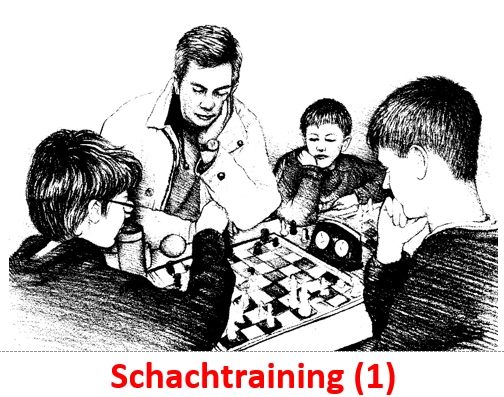
Symbolbild Schachtraining. Quelle: Brunthaler
Ein neuer Beitrag von unserem Autor Heinz Brunthaler
Mir sind keine Daten dazu bekannt und für Hinweise wäre ich dankbar. Ich selbst habe mit einer Fragebogen-Aktion im inoffiziellen Olympialager München 1972 der DSJ schon damit begonnen, mehr zum Training zu ermitteln und befragte dazu zwei Gruppen von je ca. 100 jungen Spielern. Natürlich sind die Daten von damals schon seit langem obsolet.
Damals z.B. spielte Taktik noch eine geringe Rolle, was heute ein Schwerpunkt des Trainings ist. Der Grund war wohl, dass es – anders als in den USA und der Sowjet Union – keine großen Taktiksammlungen in Buchform gab. Wieder ein Punkt, wo die Weiterentwicklung von Technik (besonders beim Satz von Diagrammen, damals noch aufwendig und teuer) das Schachwissen befördert hat!
Das Erlernalter lag bei 10,8 Jahren bei der stärkeren Gruppe und ca. ein Jahr höher bei der schwächeren, was wohl schon einen Teil des Spielstärkeunterschieds bewirkte.
Eine weitere Umfrage wollte ich Ende der 1990er bei einer DLMM der Jugend durchführen. Doch die meisten der Teamchefs boykottierten dies aus unerfindlichen Gründen und nur wenige Fragebögen kamen zurück, teils nur unvollständig ausgefüllt.
1998 habe ich in einem Papier für die DSJ (dem „Grünen Heft“) einige Betrachtungen zum Training angestellt, was sich aber hauptsächlich auf den Leistungsbereich bezog.
Lediglich zum internationalen Leistungssport gibt es einiges Material, manches davon aber unqualifiziert wie die Anwendung der dubiosen 10.000 Stunden Regel von Ericsson in 1993, was u.a. auch von IM Dr. Gobet, dem weltweit führenden Schachpsychologen, widerlegt wurde. Ein wesentlicher Irrtum (der auch bei Studien anderer Wissenschaftler vorkommt) in Ericssons Modell ist, dass er die eher reproduktive Leistung eines Musikers mit der Kampfsituation des Schachspielers gleichsetzt.
Zudem sind solche Studien meist nur eine quantitative Erfassung von Trainingszeiten. Jeder erfahrene Trainer weiß aber, dass es nicht die Masse macht, sondern Talent, Auffassungsgabe, Inhalte und Umfeld zu großen Abweichungen in der Anzahl der nötigen Trainingsstunden führen, was ebenfalls Gobet untersucht und bestätigt hat.
Ich möchte mich zunächst auf das Training der jüngsten weiblichen Altersklassen konzentrieren; nicht zuletzt auch wegen der derzeit unbefriedigenden Ergebnisse im internationalen Vergleich. So erreichte von 9 Girls in u8w und u10w bei der aktuellen Europameisterschaft nur eine von ihnen einen Platz in der 1.Hälfte (26. von 93 in der u10w, aber mit Eloverlust -61,6), was für ein Schachland wie Deutschland, das mehr Jugendliche hat als die meisten Nationen Mitglieder allen Alters, viel zu wenig ist.
Da es absolut unwahrscheinlich ist, dass die deutschen Mädchen in der Masse so viel unbegabter sind als die Mädchen zahlreicher anderer Nationen muss daher der Unterschied im Training liegen. Interessant wäre natürlich, mehr über das Training in den erfolgreichen Nationen zu erfahren, aktuell etwa der Türkei, aber das dürfte nicht leicht sein. Wir müssen also von Grund auf nach den eigenen Defiziten suchen.
Doch dies scheint niemand besonders zu interessieren, obwohl Erfolge der Mädchen auch eine Vorbildfunktion bewirken können und damit mehr Mädchen zum Training, damit zur Leistungssteigerung und letzthin zum längeren Verbleib im Klub motivieren könnte.
Zum Training Informationen und Ideen zu sammeln ist der erste Schritt. Ich hoffe, dass die Leser ihren Teil dazu beisteuern werden. Eine Art Brainstorming wäre wünschenswert. In der nächsten Folge werden wir die hoffentlich eingegangenen Beiträge dann betrachten und Ziele zur Untersuchung formulieren
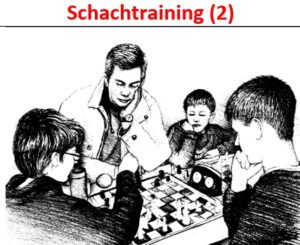
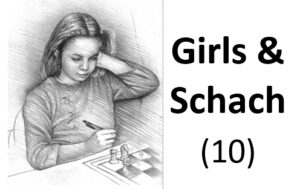
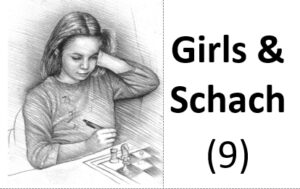
Interessant ist ja der Rückblick auf die 1970-er Jahre. Tatsächliche Trainer gab es kaum. Wer was werden wollte, musste sich selbst fortbilden. Da gab es höchstens einen Ansporn aus der Gruppe so nach dem Motto, der ist besser geworden, dann will ich das auch. Ich habe mit 2 Spielern zusammengespielt, die später Großmeister geworden sind. Die hatten keinen Trainer. So weit ich mich erinnere, waren die auch nie in einem Kader. Das dürfte dann auch der Grund sein, warum es nicht für weitere Verbesserungen gereicht hat. Es fehlte sicherlich an einer systematischen Grundausbildung. Fehleranalysen waren zeitaufwendig, da ja keine Engines als Hilfsmittel zur Verfügung standen.
Man muss da nicht lange herumreden. Wer irgendwann Spitzenleistungen erbringen will, muss eine Menge lernen. Da reicht einmal Training in der Woche am Vereinsabend nicht. Für Hobbyspieler ist das hingegen ausreichend.
Bei Talenten favorisiere ich Einzeltraining oder in der kleinen Gruppe, aber wenn es U8 ist, dann kommt eigentlich nur Einzeltraining in Frage. da ansonsten die Spielstärkenunterschiede schon zu groß sind. Da sieht man schon ein Problem. Man braucht genügend Trainer.
Für die Wissensvermittlung ist für mich Jussupow Tigersprung relevant. Nun hält sich die Realität nicht an das Training. Es gibt in den Partien immer Probleme, für deren Lösung eigentlich das Wissen fehlt. Da muss man dann auch Lösungen aufzeigen.
Hinzu kommen dann Taktikaufgaben und Endspiele.
Das ist dann schon ein ziemliches Programm. Da kann man natürlich nach Eröffnung und Mittelspiel fragen. Das kommt bei U8 nur am Rande vor, mal ab und an eine Beispielpartie.
Ansonsten gibt es eine Reihe von allgemeinen Hinweisen wie z.B. „Ungedeckte Figuren sind eine taktische Schwäche“ oder „Der König ist immer eine taktische Schwäche“, bei Matt ist die Partie zu Ende. Es soll also immer geschaut werden, ob eine solche Schwäche ausgenutzt werden kann. Fragen danach kommen im Training immer wieder vor.
Ansonsten sollte man ein einziges Turnier auch nicht überbewerten.
Grundsätzlich muss man auch die Rahmenbedingungen betrachten. In Kasachstan ist Schach Schulfach. Da ist es dann kein Wunder, dass diese Kinder zunächst mal einen Vorsprung haben. Das war dann bei der WM so.
Wenn man wissen will, welche organisatorischen Maßmahmen es in anderen Ländern gibt, dann kann man die künstliche Intelligenz bemühen.
Hallo Uwe, ich finde, dass man besonders viel durch Blitzen auf Lichess (oder chess.com) lernen kann. Das klingt vielleicht absurd, aber wenn man jeden Tag spielt, und dann auch seine Fehler kritisch analysiert (was die meisten nicht tun), und auch neue Sachen ausprobiert, dann kann man schon in relativ kurzer Zeit einiges lernen, meine ich. Die Wissensvermittlung über Schachbücher hat wohl mit den Jahren abgenommen. Und ja, ein guter Trainer, mit dem man regelmäßig arbeitet (wenn man es sich leisten kann), kann natürlich auf keinen Fall schaden.
Blitzen und Online-Schach sind durchaus wichtig. Das ist ja eine gute Möglichkeit Gelerntes anzuwenden. Das war ja früher auch schon so.
Letztlich lernt man dann aber nach dem Zufallsprinzip, nämlich Dinge, die in den Partien gerade vorgekommen sind. Es fehlt dann an der Systematik.
Im Artikel geht es um ein Alter von 8 bis 10 Jahren. Diese Kinder werden die Blitz- oder Schnellpartien nicht nachbearbeiten.
Hallo Uwe, mein Hinweis war eher allgemeiner Natur, dass der Lerneffekt im Schach heutzutage vor allem online stattfindet. Ich glaube, Schachbücher sind bei Jugendlichen ziemlich out. Das Lernen aus Schachbüchern möchte ich nicht schlecht reden, aber wer hat heutzutage noch Zeit und Lust, mit Schachbüchern zu arbeiten?
Der Unterschied beim Blitzen zu früher ist der, dass man im Verein einmal pro Woche geblitzt hat, und das war eigentlich zu wenig. Oder auch zwei Mal, wenn man in zwei Vereinen Mitglied war. Heutzutage kann man sich täglich zum Blitzen am PC einloggen, und findet immer auf Anhieb spannende Gegner. Du wendest ein, dass man quasi nach dem Zufallsprinzip lernt. Mag sein, aber auf eine sehr effektive Art und Weise! Ich bedaure, dass ich in meiner Jugend diese Möglichkeit nicht hatte. Mein erster Kontakt mit Internetschach war 1999, also vor rund 25 Jahren, und da war ich schon 40 Jahre alt. Kam also viel zu spät.
Im Bezug auf die Aussage:
„Da es absolut unwahrscheinlich ist, dass die deutschen Mädchen in der Masse so viel unbegabter sind als die Mädchen zahlreicher anderer Nationen muss daher der Unterschied im Training liegen“
Vielleicht sind die Rahmenbedingungen einfach nicht attraktiv genug für Mädchen, sich 1. dem Schach zuzuwenden, 2. dabei zu bleiben, 3. ein Großteil des Lebens dafür zu „verschwenden“.
Vielleicht, weil sexistische Kommentare und Mobbing drohen?
Vielleicht, weil Schach eine brotlose Kunst ist, die anderweitig finanziert werden muss?
Vielleicht, weil traditionelle Verein- und Verbandsarbeit durch Ü60 Männer die Jugend abschreckt?
Die Tigersprung-Reihe ist nett, aber nicht für u8 Kinder gedacht. Zielgruppe sind Hobby- und schwache Klubspieler, die sich verbessern möchten. Anders als die Kinder bringen sie aber eine lange Spielpraxis und auch ein „erwachsenes Denken“ mit. An ihren Erfahrungen kann das neue Wissen andocken.
Für die Zielgruppe u8 und besonders u8w wäre ein eigenes, auf derem praktischen Niveau angepasstes Trainingsprogramm in Buchform nötig, dass der Trainer dann anwenden könnte.
Ich habe mit meinen Broschüren versucht, einen Schritt in diese Richtung zu tun.
Das nötige Wissen wird oft überschätzt. Wichtiger ist das Verständnis, das vielen Mädchen in der u8 offensichtlich abgeht. Weiterhin das Eliminieren typischer Fehler und Schwächen. Dworetzki sagte: „95% aller Fehler sind einfache Fehler. Wenn wir die vermeiden haben wir schon viel erreicht“.
Als Trainer verwende ich hauptsächlich die Methode, mit dem Schüler (den Schülern in Form von Handicap-Rapidpartien) Schnellpartien zu spielen, auf Fehler / Schwächen hinzuweisen, Fragen zu stellen, manchmal etwas zu erklären, was der Schüler dann sofort in sein Spiel integrieren kann. Also das Spiel „stromlinienförmger“ zu machen, praktisches Wissen einzustreuen und durch Fragen Planung und logisches Spielverhalten zu verbessern. Dabei sind Eröffnung und Mittelspiel besonders wichtig, denn ohne besseres Spiel dort wird Schüler/in gar nicht erst in ein haltbares Endspiel kommen.
Für Mädchen ist die richtige Eröffnung wichtig. Ihr Hang zum eher abwartenden, defensiv orientierten Spiel wird durch manche Eröffnungen noch verstärkt. Offene Spiele fördern zudem das praktische Erlernen und Erleben der Taktik. Wie soll Sofi Taktik erleben, wenn sie als Weiße London System mit c3 spielt. Kein guter Trainer würde einem Anfänger Caro-Kann beibringen, was ebenfalls wenig in Richtung Taktikverständnis bietet. Das kann anfangs einige Erfolge bringen, führt aber in eine Sackgasse. Die Partien im Bereich der ersten 10 bei der Europameisterschaft gu8 zeigen, was gutes Training bringt. Nach vorne spielen, strategische Grundlagen beherrschen, die Eröffnung verstehen.
Die Tigersprung-Reihe bringt eine Systematik von dem Stoff, den man wissen sollte. Da wird auch nicht jedem Kind mit 8 Jahren vorgelegt, das die Grundlagen gerade beherrscht. Viele Vereinsspieler wären erheblich besser, wenn sie diese Grundlagen beherrschen würden.
Ziel des Trainings ist auch nicht das nächste Turnier, sondern die Steigerung der Spielstärke. Läuft es gut, dann ist es schön, wenn nicht, dann ist das auch kein Drama.
Eröffnungen wurden mit Sofi nicht besonders geübt. Da wird es im Alter von 8 Jahren eh immer Lücken geben, so dass das Kind nach allgemeinen Eröffnungsprinzipien spielen muss. Letztlich muss dann immer nachgearbeitet werden. Dann werden dazu ein oder zwei Partien gezeigt.
Mich begeistert das Londoner System auch nicht. Ich werde es aber nicht verbieten. Aber auch bei dieser Eröffnung spielt die Taktik irgendwann bei Spielen von Kindern eine Rolle.
Mit Caro Kann habe ich keine Probleme, wenn ein Kind von sich aus das spielen will. Oft wird Kindern ja Skandinavisch beigebracht, weil das zu einheitlichen Stellungstypen führt.
Die offenen Eröffnungen führen nicht unbedingt zu offenen Stellungen. Den Kindern wird oft Italienisch mit d3 beigebracht. Wenn dann auch noch der Springer nach c3 gestellt wird, führt das oft dazu, dass alle Leichtfiguren getauscht werden, und dann fällt den Kindern nichts mehr ein.
Mit Schottisch habe ich bei jungen Kindern ein Problem. Viele Varianten finde ich zwar geeignet, allerdings nicht die Hauptvariante, in der es darum geht, die Entwicklung des Gegners zu behindern. Züge wie De7 vor der Entwicklung des Läufers auf f8 und dann De2 vor der Entwicklung des Läufers auf f1 müssten gut erklärt werden. Die Stellung ist aber dann nicht einfach zu spielen. Was da passiert, dürfte mindestens zwei Nummern zu hoch sein für die Kinder.
Copilot liefert zur Förderung des Jugendschachs Folgendes:
„Strukturen der Jugendschachförderung in der Türkei
1. Schulschachprogramme
Seit den 2000er Jahren ist Schach in vielen türkischen Schulen als Wahlfach eingeführt.
Ziel: möglichst viele Kinder frühzeitig mit Schach vertraut machen.
Lehrer erhalten spezielle Schachtrainer-Lizenzen über den Verband.
2. Nationale Jugendmeisterschaften
Jährlich organisiert der TSF die Türkische Jugendmeisterschaft mit Altersklassen von U8 bis U18.
Sieger qualifizieren sich für Europäische und Weltmeisterschaften.
Parallel gibt es Teammeisterschaften für Schulen und Vereine.
3. Talentförderung & Akademien
Der Verband betreibt Talentförderzentren („Satranç Akademileri“) in großen Städten wie Ankara, Istanbul und Izmir.
Junge Talente werden dort durch professionelle Trainer betreut.
Es gibt Förderprogramme für Titelträger-Nachwuchs (FM, IM, GM).
4. Internationale Austauschprojekte
Über die Deutsch-Türkische Jugendbrücke und Programme wie den KJP-Matching-Fund werden Begegnungen zwischen deutschen und türkischen Jugendlichen gefördert.
Auch Sportjugend-Projekte (z. B. Schach- und Jugendsportaustausch) sind Teil der Förderung.
5. Breitensport-Initiativen
Regelmäßige Schachfestivals und offene Turniere für Kinder.
Kooperationen mit Kommunen und Kulturzentren zur Förderung von Schach als Freizeitaktivität.“
Ich finde es ansonsten lobenswert, wenn sich jemand um Trainingsaspekte bemüht und das auch aufschreibt. Den einzigen Königsweg wird es eh nicht geben. Von daher ist es schon interessant, wie das Training wo anders aussieht.
Zu Rolands Text:
Sorry, Roland, aber deine Annahmen sind zweifelhaft bis unlogisch (und abgesehen davon auch off topic). Schauen wir uns die einzelnen Punkte mal an:
Sind die Rahmenbedingungen etwa in Polen oder gar der Türkei so viel besser für Mädchen als in Deutschland?
Wieder werden „sexistische Kommentare“ und „Mobbing“ angeführt, was sich u.a. beim derzeitigen Stand des „10.000 € Projektes“ nicht als wesentlicher Grund der Vereinsaustritte gezeigt hat. Viele Jungen verlassen den Verein ja auch in der U14, die davon wohl kaum betroffen sind, oder?
„Ein Großteil ihres Lebens dafür (Anmerk.: für Schach) zu ‚verschwenden‘ “ ist reine Polemik. Erstens reden wir von Kindern, die genug Freizeit haben. Ob sie später viel Zeit für Schach aufwenden ist fraglich; in den meisten Fällen wohl nicht der Fall. Und jedes andere Hobby wäre auch „Zeitverschwendung“.
„Vielleicht, weil Schach eine brotlose Kunst ist, die anderweitig finanziert werden muss?“
Da trifft auf jedes andere Hobby / jeden anderen Hobbysport auch zu – und kostet meistens mehr. Schach ist wohl eine der billigsten Sportarten, während schon Laufschuhe und Sportklamotten für den Hobbysportler mehr ins Geld gehen.
„Vielleicht, weil traditionelle Verein- und Verbandsarbeit durch Ü60 Männer die Jugend abschreckt?“
Das ist ganz einfach nur Vorurteil und Diskriminierung. Die Alten können der Jugend viel vermitteln und diese weiß das auch durchaus zu schätzen. Ich bin sogar Ü75, also schon Nestor, und meine Schüler sind immer gerne zu meinem Training gekommen. Ich habe in meinem Leben viele alte ehrenamtliche Jugendleiter / Trainer kennengelernt, die von den Kids sehr geschätzt wurden. Und, wenn die Alten es nicht machen würden, wer würde es sonst tun?
Schach ist ein Wert fürs Leben, hat viele pädagogische Aspekte, verbindet die Generationen, ist eine anspruchsvolle Freizeitbeschäftigung u.v.a.m. und ist es wert, Kindern vermittelt zu werden.
Hallo Heinz. liebe Schachfreunde,
Anderes Thema, auch innovativ:
Vielfältiger Content zu Schach und Quantentheorie steht zur Verfügung:
Schach ist eine der genialsten Erfindungen des menschlichen Geistes. Quantenmechanik, obwohl allgegenwärtig und täglich milliardenfach technisch angewandt, versteht keiner wirklich. Eine reizende Ausgangslage: wie wär’s mit einer Kombination!? Der Reichtum des Schachs ermöglicht es, das Spiel auch als Metapher oder Paradigma für intellektuelle Herausforderungen heranzuziehen.
Schachfreunde, Vereine, Websites, Organisationen… Wer daran interessiert ist. möge sich bitte im Kommentar hier melden!
Um zu zeigen, was schon erarbeitet wurde, bringe ich auch eine Inhaltsübersicht.
Beste Grüße Dr. Reinhard Munzert
Schach und Quantentheorie,
Inhaltsübersicht:
Willkommen im Neuland!
Sehenswürdigkeiten, Rätsel und das Unfassbare
2. Kapitel Auf den Schultern von Geistes-Riesen
3. Kapitel Schach und klassische Physik: Kraft, Raum, Zeit
4. Kapitel Schach und Relativität
5. Kapitel Das Denk- und Spielmaterial: Schach, Quanten und Wellen
6. Kapitel Das Jahrhundert-Match zur (Be)Deutung der Quantenphysik
7. Kapitel Quanten setzen gesunden Menschenverstand Matt
8. Kapitel Quantenversteher & Gedankenspieler gesucht! – Was hat das Alles zu bedeuten?
9. Kapitel Schach und Wissenschaft
10. Kapitel Ein Anwendungsbeispiel: Schach und die Vereinheitlichung der Psychologie
11. Kapitel Schach – auch eine Wissenschaft?
12. Kapitel Zur wissenschaftlichen Erforschung des Schachspiels und „der“ Schachspieler
13. Kapitel Das SCHACH-Prozess-Modell
14. Kapitel Schach als Forschungs-Instrument
15. Kapitel Schach und Quanten(-Physik): Parallelen und Gemeinsamkeiten
16. Kapitel Quantenverschränkung, „spukhafte Fernwirkungen“ (Einstein) und die Würfel-Metapher
17. Kapitel Ist Quantenverschränkung an Wechselwirkungen von Schachfiguren darstellbar?!
18. Kapitel Ein wunderbares Beispiel: Das Indische Schachproblem
19. Kapitel Ausdehnung des Schachraums, Fernwirkung und Verschränkungsmatrix
20. Kapitel Spooky checkmate at a distance: Schach und Matt auf weite Entfernung
21. Kapitel Vergleich: Würfel-Metapher und Schach-Metapher
22. Kapitel Das Mögliche und das Faktische
23. Kapitel Der mentale Hauch der Schachspieler
24. Kapitel Die Wellenfunktion eines Schachgedankens (1. Annäherung)
25. Kapitel Bewusstsein, Unbewusstes – determinierende Tendenz(en) und Quanten
26. Kapitel Mensch, Gehirn und Physik-„Software“ im Kopf
27. Kapitel Psychisches Betriebssystem, Neuronale Netze, Assoziatives Gedächtnis, Informationsverarbeitung, Kognition, Motivation & Handeln
28. Kapitel Neuronen: „Schmetterlinge der Seele“ – Chaostheorie: „Der Schmetterlingseffekt“
29. Kapitel Zur Quantenphysik mentaler Prozesse: Der QUANTEN-SCHMETTERLINGSEFFEKT
30. Kapitel Prozess- und Strukturverschmelzung, Quantum-Chunking und Emergenz
31. Kapitel Die Wellenfunktion eines Schachgedankens (2. Annäherung)
32. Kapitel Ein Schachparadigma zur Quantenphysik
33. Kapitel Quantenphysik bei GRÖSSEREN Objekten und Lebewesen
34. Kapitel Vom Doppelspalt-Experiment zum kosmischen Doppelgänger
35. Kapitel „Gott würfelt nicht“ – Spielt er Schach?
Dr. Reinhard Munzert 2025
Noch eine Anregung.
In der Mathematik ist die Eulersche Springerwanderung bekannt. Ein Springer z.B. beginnend auf a1 muss alle Felder des Schachbretts genau einmal besuchen. Landet er mit dem nächsten Zug wieder auf a1, dann ist die Wanderung geschlossen, ansonsten offen.
Euler hat 1759 einen geschlossenen Pfad nachgewiesen. Die Springerwanderung ist ein Beispiel für einen Hamiltonkreis. Hamiltonkreise spielen meines Wissens bei der Modellierung in der Quantenmechanik eine Rolle.
Leider muss man da nicht mehr selbst eine Lösung finden. Die wird einem von der KI gezeigt. Schade eigentlich!
Lieber Schachfreund Uwe Böhm! Ich habe mich gefreut, dass Sie in einen Dialog eingetreten sind, wenn auch „Ich finde es ansonsten lobenswert, wenn sich jemand um Trainingsaspekte bemüht und das auch aufschreibt.“ etwas herablassend klingt.
In Ihrer Auffassung zum Training stellen Sie Wissensvermittlung in den Mittelpunkt, vielleicht auch, weil das Teil ihres autodidaktischen Wegs war, ein starker Spieler zu werden. Eher eine Form des deduktiven Lernens.
Meine Trainingsauffassung ist eher induktiv, bevorzugt Verstehen über Wissen. Besonders positiv ist, dass nicht Wissen akkumuliert wird, das eines Tages vielleicht gebraucht wird, sondern solches, das sofort – bereits in der Trainingspartie – greift und eine bleibende kleine Verbesserung bewirkt (z.B. Vermeidung unnötiger Züge, Planlosigkeit). Das entspricht mehr der Entwicklung von Anfängern und jungen Spielern. Tatsächlich braucht man recht wenig Wissen, um auf dem Niveau von z.B. DWZ 1.400 zu spielen. Auf dem Weg dahin – und noch darüber hinaus – ist Mark Dworetzkys „95% aller Fehler sind einfache Fehler. Wenn wir die vermeiden haben wir schon viel erreicht“ der richtige Leitfaden.
Ich habe vor ca. 20 Jahren begonnen, mich mit dem Spiel und Training von u10 zu beschäftigen und damals einige Broschüren dazu verfasst. Um 2016 habe ich mich als Co-Autor von GM Thomas Luthers Buch „Das U10-Projekt“ intensiver damit beschäftigt, wozu ich über 1.500 Partien u8 und u10 analysiert und bewertet habe. Im Rahmen anderer Buchprojekte und in jüngerer Zeit auch bei der Arbeit meines Buches „SchachTraining“ sowie jüngst der Diskussion zum Gender Gap habe ich dies noch ausgeweitet, insgesamt über 3.000 Partien von Kids untersucht, was in den letzten Monaten u.a. zu den drei Broschüren „Schachtraining für Girls“ führte.
Ich glaube nicht, dass es viele Experten gibt, die eine ähnlich umfangreiche Betrachtung des Kinderschach vorweisen können und Sie sehen wohl, dass ich eine ganze Menge dazu „aufgeschrieben“ habe.
Zur Eröffnung: Wenn Kids in einer normalen Schulschach- oder Jugendgruppe eine Eröffnung spielen, die nicht empfehlenswert ist, kann man das durchgehen lassen (würde ich aber nicht tun). Wenn man ein Talent entwickeln will, muss man jedoch dort eingreifen und das Kind überzeugen, eine andere Eröffnung zu spielen.
Mit der „Italienisch-Kritik“ haben Sie durchaus Recht, gerade das Vierspringerspiel in all seiner symmetrischen Öde ist eine Crux des Mädchenschachs. Aber es gibt genug andere offene Eröffnungen, die das Verständnis von Taktik fördern. Ihre Kritik an Schottisch teile ich nicht, denn es ist nur eine Variante von vielen, die Ihnen nicht gefällt und so etwas gibt es in jeder Eröffnung. Tatsächlich habe ich in meiner Untersuchung keine einzige Partie mit solchen Varianten gesehen. Sie sind da wohl zu pessimistisch.
Sie schreiben: “ Mich begeistert das Londoner System auch nicht. Ich werde es aber nicht verbieten. Aber auch bei dieser Eröffnung spielt die Taktik irgendwann bei Spielen von Kindern eine Rolle.“
Okay, abgesehen von einigen blutarmen Schiebepartien kommt fast immer irgendwann Taktik ins Spiel. Aber London und geschlossenes Spiel begrenzt Taktik in Art und Umfang und lässt einen riesigen Bereich aus, der für die Entwicklung wichtig ist. Das defensive Spiel der Girls wird von solchen Eröffnungen noch betont und vergrößert den Unterschied zum Spiel der Boys, was Sie vermutlich nicht wussten. Neuerdings spielte Sofi auch Sizilianisch, was ihr aber einige deftige Niederlagen einbrachte. Was hat sie bei der Europa-Meisterschaft gespielt?
Tatsächlich wurde ich vor einer Weile selbst einmal mit dem Problem konfrontiert, als ich das Training eines 14-jährigen, schachbegeisterten und hochintelligenten Jungen übernahm, dem sein Trainer 1.d4 und Caro-Kann verpasst hatte. Er hatte nie offen gespielt. Auch dieser Trainer legte das Schwergewicht auf Kenntnisse, gab regelmäßig Lektionen. Ich brauchte zwei Jahre, um die dadurch entstandenen Defizite auszubügeln.
Ich schätze, Sofi wird durch die verfehlte Eröffnungswahl ein Jahr verlieren. Hoffentlich bewirkt es keinen dauerhaften Schaden, der ihre Entwicklung über ein gewisses Maß hinaus negativ beeinflusst. Sie muss lernen, „das Spiel zu machen“, wie es im Fußball heißt, aktiv und nach vorne zu spielen, die Gegner/innen zu überspielen statt nur auf deren Fehler zu warten.
Ich habe alle Partien von Sofi, die ich downloaden konnte, nachgespielt. Sie hat erhebliche taktische Schwächen, sieht oft selbst einfache Möglichkeiten nicht und bietet den Gegnerinnen, die zum Glück noch weniger Ahnung haben, Chancen von Matchball-Qualität.
Ihre Partien zeigen, dass sie kein natürliches Top-Talent ist. Ihre Stärke ist, weniger einzustellen als ihre Gegnerinnen und wohl auch ihre Schachbegeisterung. Der Vorteil des solideren Spiels verblasst jedoch von Jahr zu Jahr mehr und wird schon im kommenden Jahr in der U10w von geringerem Wert sein. “Watch out for her – she will be Germans future” ist maßlos übertrieben und wird durch so gut wie nichts untermauert. Elisabeth sollte es aus ihrer eigenen Erfahrung besser wissen.
Lieber Schachfreund, schauen Sie sich die Partien aus der Spitze der Europameisterschaft an. Sie werden sehen, dass das Verständnis der Eröffnungen dort ungleich besser ist, nicht nur bei der Siegerin, die tatsächlich beeindruckt, sondern auch bei den türkischen Girls. Sie müssen mit Sofi daran arbeiten. Damit meine ich nicht etwa Varianten büffeln, sondern in Trainingspartien alles mögliche und manches unmögliche ausprobieren lassen, um den Sinn der Eröffnungen zu zeigen, ein Gefühl für das Machbare zu entwickeln und dies zu vertiefen.
Auch taktisches Training ist notwendig. Ich würde sie in Trainingspartien offene Eröffnungen spielen lassen, was auch als „second Service“ gegen schwache Gegner nützlich sein könnte und sie auf jeden Fall schwerer ausrechenbar machen würde.
Was ist eigentlich mit dem FM-Trainer? Ist es Internet-Training? Er scheint in der Ukraine zu leben?
Wichtig wäre besonders, dass Sofi mit stärkeren männlichen Gegnern spielt. Ich habe für meinen jeweiligen Schüler regelmäßig informelle Rapid-Turniere am Wochenende organisiert, was sich sehr positiv ausgewirkt hat. Sollte das nicht bei Ihnen möglich sein?
Danke für die Info zum türkischen Schach. Die ist allerdings für das Thema „Training“ ohne Bedeutung, da es sich um eine Übersicht der organisatorischen Maßnahmen handelt. Für das individuelle Training ist das aber nur sehr bedingt von Belang. Material zum Training der jungen türkischen Talente wird ganz gewiss nicht veröffentlich werden, die türkischen Trainer halten ihre Karten bestimmt dicht an der Brust.
Das sollte gar nicht abwertend sein. Es ist doch in der Tat so, dass es kaum Bücher gibt, die sich mit der Thematik befassen, wenn es ein Stück über den Anfängerbereich hinaus geht.
Die Zielrichtung ist aber nicht Elo 1400 oder 1500. Gewisse Sachen muss man einfach lernen, und je früher desto besser.
Die EM ist nun nicht so gut gelaufen. Eigentlich hätte sie aus den ersten drei Partien 3 Punkte machen können, hat aber die zweite und dritte Partie verloren. Das war schon tragisch. In der zweiten hatte sie sehr gut gespielt und praktisch einen einzügigen Gewinn ausgelassen und stattdessen einen Bauern gewonnen. In der dritten Partie hatte sie nicht mehr auf der Rechnung, dass die Gegnerin nach dem 30. Zug noch rochieren konnte, Rochade mit Schach und Turm weg. Ich habe ja selbst mal so gewonnen gegen einen Gegner mit ca. 2300 Elo. Der hatte das auch nicht auf dem Schirm. Danach war das Turnier schon fast gelaufen. Das wird dann eben nachgearbeitet und das nächste Mal hoffentlich besser gemacht. Sofi hat noch Online-Training mit einem ukrainischen IM, der als Trainer auch schon Erfolge hatte.
Der DSB hatte ja Trainer vor Ort, aber angeblich war keiner für Sofi zuständig. Eigentlich wollte ich das gar nicht schreiben, aber das könnte ja auch ein Unterschied zu den türkischen Kindern sein.
Ich habe mir die Partien der Siegerin und auch da gab es reichlich Fehler, auch in der Eröffnung. Man muss dann auch mal Glück haben, dass dies nicht ausgenutzt war.
Das Londoner System ist vielleicht etwas lahm, aber auch das kann man nach vorne spielen.
Ich habe zumeist Caro Kann oder Französisch gespielt. Von daher kann ich nicht bestätigen, dass Caro Kann eine Remiseröffnung ist. Das ist eine klassische Eröffnung, in der ein oder zwei Leichtfiguren getauscht werden. Das ist auch vernünftig, weil Schwarz etwas weniger Raum hat. Dann gewinnt normalerweise der, der die Partie besser spielt.
Es mag ja sein, dass andere Kinder bessere Eröffnungskenntnisse haben. Das ist aber mit 8 Jahren nicht entscheidend. Ein Beispiel ist die folgende Partie (https://lichess.org/broadcast/fide-world-cadet–youth-rapid–blitz-championships-2025–blitz-girls-u8/round-4/Cab57SKL/TbPVPkNa ) . Das ist eine Blitzpartie aus der WM U8 w. Die Gegnerin ist die absolute Nummer 1 in der Altersklasse. Die hat Schnellschach und Blitz jeweils mit 11 Punkten aus 11 Partien gewonnen. Das war vermutlich die einzige Partie, in der sie überhaupt gefordert wurde. Die hat dann dieses Jahr dann auch noch die Weltmeisterschaft U8 w gewonnen mit 10 aus 11.
Die meisten einsehbaren verfügbaren Partien sind Blitz- und Schnellschachpartien. Die sollte man dann auch nicht zu kritisch betrachten. Da gibt es reichlich Fehler, bei den Gegnerinnen aber auch.
Caro-Kann ist natürlich keine Remiseröffnung, aber durch die beengte Stellung bietet es im Mädchenschach keine Angriffsfläche und wenn Weiß auch nichts macht und beide Seiten kräftig tauschen verflacht die Partie. Ich habe gegen meinen Schüler in den Trainignspartien die Vorstoßvariante gespielt und wild, auch manchmal inkorrekt, angegrifffen, damit er gezwungen war, Taktik zu erkennen und dagegen zu halten.
Die Blitzpartie ist typisch für das, was ich schrieb. Schwarz steht nur da, etwas beengt, Taktik ist nicht möglich und wenn dann für Weiß und wenn Weiß genauer spielt, bringt das für Schwarz auf Dauer Probleme, die Kinder überfordern können.
Natürlich machen die Kinder alle Fehler, aber der Spielstil ist der entscheidende Punkt. Taktisches Verständnis ist ein Teil davon. Das gilt besonders für die Weißpartien.
Ich hoffe, ich irre mich, denn ich gönne der Kleinen von Herzen den Erfolg. Ich schreibe das mit einigem Zeitaufwand nicht um des böswilligen Kritisierens willen, wie mir einige von Sofis Sympathisanten unterstellt haben (wie konnte ich es wagen?) und mir deshalb böse waren (und offensichtlich inkompetent), sondern um zu helfen und Anregungen zu geben, die von den emotional befangenen Personen in ihrem Umfeld manchmal nicht selbst gesehen werden. Ich denke schon, Sie werden ein wenig über meine „Kritik“ nachdenken und doch das ein oder andere aufgreifen.
Viel Erfolg!
Danke! Die Bücher werde ich mir auch zu Gemüte führen. Es kann ja nicht schaden, dazu zu lernen. Ich hätte ja auch nichts gegen ein Konzept des DSB.
Mit den Eröffnungen sollte man es sich nicht zu einfach machen. Ich hatte bez. der Rapid- und Blitz-WM geschaut, was die Kinder so spielen. Die Weltmeisterin U8 spielt oft die Philidorverteidigung mit Damentausch und überspielt dann ihre Gegnerinnen. Wenn die Eröffnung maßgeblich sein soll, dann dürfte aus der nicht viel werden. Die dürfte aber in Kürze Elo 2000 haben.
Bei den Jungen U8 haben die Sieger im Blitz und Rapid beide gegen 1.e4 mit Caro Kann eröffnet. In Lichess ist nur die Notation für die ersten beiden Bretter zu sehen. Gefühlt wurden an diesen beiden Brettern die Hälfte der Partien mit Caro Kann eröffnet. Mir ist nur eine Partie mit 1. e4 e5 in Erinnerung und das war ein Italienisches Vierspringerspiel. Der Weltmeister U8 Rapid ist dann wohl auch noch noch Weltmeister im Normalschach geworden.
Die meisten Partien waren dann beim Caro Kann dann Panow, dann ein paar mal die Abtauschvariante und das Zweispringerspiel. Hauptvariante und Vorstoßvariante kamen anscheinend nicht vor.
Nach den ersten beiden Eröffnungszügen bestimmt dann Weiß, wie es weiter geht. Da kann man Schwartz keinen Vorwurf machen, für was sich Weiß entscheidet.
An der obigen Partie interessieren mich die Fehler in besserer Stellung und in ausgeglichener Stellung.
Meine späten Bemerkungen: Generell ist ja die Frage, was man mit Training erreichen will (und kann). Auf Vereinsebene geht es zunächst einmal darum, dass Kinder Spaß am Schach haben (und behalten). Dann vielleicht, dass sie ihr Potential (was auch immer das ist) ausreizen und dass sie an Erwachsenen-Mannschaften herangeführt werden – jeweils sollte man sie fördern und fordern aber nicht überfordern.
Zukünftige Titelträger und Schachprofis erzeugen ist wohl höchstens die Ausnahme, bei Landes- und Bundeskader mag es eine Rolle spielen aber auch nicht unbedingt. Bei Sofi spielt es wohl noch keine Rolle, bei etwas älteren Kindern – männlich oder weiblich – auch nur im Einzelfall: Talente wie Christian Glöckler, oder ein Supertalent wie Yagiz Kaan Erdogmus.
Und das Training sollte angepasst sein an individuelle Interessen, Stärken und Schwächen. Wenn jemand Sizilianisch gar nicht mag oder gar nicht damit zurecht kommt bringt es nichts zu sagen „Du musst aber“!?
Bei Blitzpartien im Internet spielt neben der Tatsache, dass man beliebig viele spielen kann (zu viele sollten es vielleicht auch nicht sein) ja noch etwas eine Rolle; „der Server schreibt mit“, die Partien bleiben erhalten. Man kann sie danach selbst analysieren (mit oder ohne Engine), das kann auch ein Trainer machen. Es wird zwar auf einzelne Partien bezogen ein bisschen „Zufallsprinzip“, ab einer gewissen Menge wird es „aussagekräftig“ – durchaus Hinweise auf Stärken und Schwächen.
Ich hatte mir einmal alle Partien meiner Schützlinge in einem Teamturnier angeschaut, daraus wurde dann eine Trainingseinheit zu Endspielen – was sie und ihre Gegner nicht gesehen hatten, keine „Feinheiten“ sondern relativ elementare Dinge. Mit Beispielen aus eigener Praxis ist der Lerneffekt vielleicht auch größer als wenn man ihnen das theoretisch beibringen will – vielleicht auch nicht und ohnehin muss man Lektionen oft wiederholen.
Wofür Internet-Partien auch nützlich sind: wenn jemand neu im Verein ist und bereits im Internet gespielt hat bekommt man einen Eindruck, was er (oder sie) bereits kann und kann dann entscheiden „direkt in die erste Fortgeschrittenen-Gruppe, nicht mehr reiner Anfänger. Von Eltern wollte ich neben der Internet-Elo auch den Usernamen wissen, damit ich mir schon einen Eindruck verschaffen kann.
Zwei Dinge möchte ich klarstellen:
– Ich habe nichts gegen Caro-Kann.
– Wir müssen unterscheiden zwischen dem Training von Jungen und dem von Mädchen in den jüngsten Altersklassen.
Mädchen neigen zu einem zurückhaltenden, manchmal sogar passiven Spiel, während Jungs eine angriffslustige Disposition zeigen. Dies mag sogar zum Gender Gap beitragen. Caro-Kann ermöglicht (ausgenommen die Vorstoßvariante, die aber offenbar niemand spielt) eine Aufstellung, die auf engem Raum Routinezüge abspult und, wenn Weiß nicht viel unternimmt und einiges abgetauscht wird, die Stellung verflacht. Das verstärkt im Mädchenschach auf beiden Seiten diese zurückhaltende Disposition und führt zu schwächeren taktischen Fähigkeiten, die andauern können. In der DEM u18w etwa wurden in einer Runde 13 der 14 Partien durch einen groben taktischen Fehler entschieden, die 14.Partie war ein lahmes Geschiebsel, Remis.
Das allein wäre nicht einmal so schlimm, aber wenn Mädchen mit Weiß auch noch geschlossen spielen, haben sie wenig Gelegenheit, Taktik überhaupt zu erleben. Es reicht nicht aus, Taktikaufgaben zu lösen, man muss mit Taktik im Spiel konfrontiert werden und das fördert das Spiel und die Entwicklung der Kinder, u.a. in Variantenberechnung und Planung.
Ich würde Caro-Kann aber weder für Boys noch Girls als ersterlernte Eröffnung empfehlen, zuerst (vielleicht für ein Jahr) sollten Anfänger eine Weile offen spielen, also 1…e7-e5. Bei Mädchen sollte dieser Zeitraum meistens länger sein.
Training ist eine vielschichtige Angelegenheit. Zwischen Anfängertraining und Leistungstraining ist der Abstand riesig, was viele Schachfreunde unterschätzen.
Schachfreund Thomas Richter schrieb: „Zukünftige Titelträger und Schachprofis erzeugen ist wohl höchstens die Ausnahme, bei Landes- und Bundeskader mag es eine Rolle spielen aber auch nicht unbedingt.“
Tatsächlich ist das als Trainingsziel gar nicht möglich. Und auch aus den meisten Länderkader-Spieler/innen wird nicht viel. Das Top-Talent ist eine rare Ausnahme, die zufällig und nicht planbar auftritt. Ein paar Zahlen, um das zu verdeutlichen (aus „Das U10-Projekt, GM Thomas Luther, S.22):
Weltmeisterschaft u8 Al-Ain 2013
1.Pragg: 1 Fehler in 573 Zügen — Der Beste mit 5,5 aus 11 (50%) machte 23 Fehler, ein Fehler alle 21 Züge. (Das betrifft nur taktische Fehler, Minimum ein Bauer.)
Das zeigt, wie groß schon früh der Abstand zwischen einem guten jungen Spieler und einem Supertalent ist. Selbst ein guter Trainer mit erheblicher Spielstärke kann solch ein Talent nur ganz kurz trainieren, dann muss ein starker IM oder besser GM das übernehmen.
Leider ist unser heutiges Training nur sehr bedingt in der Lage, mit einiger Sicherheit zu bestimmten Spielstärken zu führen. Abgesehen vom Polgar-Modell (und auch das ist nicht sicher) können nur Zufall und Auswahl zum Top-Level führen. Außerdem muss Trainee auch wollen. Ein Beispiel dafür ist Luke McShane, mit 8 1/2 Jahren Jugendweltmeister u10 (u.a. vor Bacrot und Grischuk), wohl das größte Talent seiner Generation, der nach Abitur und Studium nur jeweils ein bzw. zwei Jahre Zeit für Schach aufwandte, dabei 2.700 Elo erreichte und sich sicher in der Weltspitze festsetzen konnte, aber den Beruf wählte und nur noch gelegentlich spielte. Es gibt eine ganze Reihe solcher Beispiele auf geringerer Ebene; keineswegs jeder möchte Profi werden – und viele sind damit auch gut beraten.
Übrigens erreichen von den 27.000 Jugendliche bis u18 nur einige hundert DWZ 1.800, der Trainingserfolg ist also deutlich begrenzter, als die meisten Schachfreunde sich vorstellen.
Zitat Thomas Richter: „Wenn jemand Sizilianisch gar nicht mag oder gar nicht damit zurecht kommt bringt es nichts zu sagen ‚Du musst aber‘!?“
Eine Eröffnung aufzuzwingen ist natürlich völlig falsch. Bei einem normalen Schüler ist es letztlich egal, wie er/sie eröffnet, auch wenn es z.B. ein fragwürdiges Gambit ist o. dgl. Bei einem Kind, das in Richtung Spitze strebt / dahin geführt werden soll, muss der Trainer aber ggfls. eingreifen und eine nicht passende Eröffnung „abbiegen“. Der Spaß ist eingeschränkt, wenn man hohe Ziele anstrebt.
Wichtig ist auch das Umfeld. „Total Immersion“ ist die beste Methode, eine Sprache zu lernen und das wirkt auch im Schach. Robert Hübner z.B. hatte das Glück, in einem Verein aufzuwachsen, dem Mitglieder der erweiterten deutschen Spitze angehörten. In einem Dorfklub mit „Spitzenspielern“ von 1500-1700 wäre er trotz seines Talents wohl nicht zum Weltklassespieler herangereift.
Die Trainerausbildung ist allgemein unzureichend und nutzt viele Möglichkeiten nicht. Es fehlt auch an Material zur Selbstaus- und Weiterbildung von Trainern. GM Thomas Luther und ich haben das 3bändige „Hand- und Arbeitsbuch für den Schachtrainer“ verfasst, das aber kaum genutzt wird (Schade, es stecken weit über 1.000 Arbeitsstunden darin). Der DSB kann nichts Vergleichbares aufweisen, trotz einem Referat „Ausbildung“. Auf dessen Homepage findet sich z.B. ein Auszug aus Laskers 100 Jahre altem Lehrbuch, in dem Lasker 200 Stunden ausreichend zur Schachausbildung annimmt, eine völlig unrealistische Einschätzung, die nicht hilfreich ist (Schachpsychologe und GM Krogius rechnte mit 800-1.000 Std.). Es gibt nicht einmal eine Aufstellung über betreffendes Material bzw. Rezensionen, man sammelt nicht einmal die Puzzlesteine auf. Da wäre viel zu tun, aber niemand tut was.
Ein Buch als Begleitmaterial zur Ausbildung von C-Trainern, ein Leitfaden / Materialsammlung für das u8 / u8w Training wäre hilfreich, ist aber nicht in Sicht. Wenn da jemand ran gehen will ist ihm meine Unterstützung sicher, aber da sollte ich wohl nicht zu viel (überhaupt was?) erwarten.
Als lächerlich empfand ich die Forderung bei der Regionalkonferenz zum „10.000 € -Projekt“ in Lehrte („rege besucht“ = 13 Teilnehmer/innen! Okay, in Sachen Mengen kann man schon mal unterschiedliche Auffassungen haben, nicht wahr?):
„Deutlich wurde in den Diskussionen, dass es eine wichtige Aufgabe ist, das Selbstbewusstsein der Mädchen zu stärken, um zum einen sich im männerdominierten Schach zu behaupten, und zum anderen sich dem Wettkampf zu stellen. Bei dieser Aufgabe kommt den Trainern und vor allem den Trainerinnen eine große Bedeutung zu. Sie haben generell, aber vor allem im Mädchenbereich, mehr Aufgaben als nur das reine Schachwissen zu vermitteln. Sie müssen sich der Aufgabe stellen, die Persönlichkeiten der Mädchen und Frauen zu stärken.“
So, liebe Trainerkollegen, wisst ihr, was von euch verlangt wird! Ist es nicht schon schwer genug, das nötige Schachwissen zu vermitteln (die Masse aller Trainerinnen dürfte eher schwach sein und da schnell an ihre Grenzen stoßen) und nun sollen auch noch Aufgaben hinzukommen, die selbst für Psychologen / Psychotherapeuten nicht einfach zu handhaben wären.
Und, nicht zu vergessen, es gibt ja auch noch die andere Forderung:
„Nicht jede sucht im Schach die sportliche Herausforderung, oftmals steht im Mittelpunkt das Schach spielen mit Freundinnen in einem angenehmen Rahmen, für den die Vereine sorgen sollten.“
Wie soll man Mädchen trainieren, für die Schach und eine (wenigstens geringe) sportliche Verbesserung nicht im Mittelpunkt stehen?
Es wird immer wieder behauptet, Geld sei das Problem. Das das stimmt nur bedingt. Vieles ist da, muss nur genutzt werden. Vieles könnte durch Kontakte ermöglicht werden. Den Verstand zu benutzen würde oft schon reichen – oder wenigstens den Unverstand einzuschränken. Aber Geschwätz ist natürlich einfacher und befriedender als etwas anzupacken
Eine Erhebung, wie trainiert wird, finde ich lobenswert. Eigentlich ist es schade, dass sich der DSB wenig um dieses Thema kümmert. Ich werde mir die Handbücher anschauen.
Selbst der Zeitaufwand von 800 bis 1000 Stunden für die Schachausbildung ist maßlos untertrieben. Krogius meinte ja wohl den Spitzenbereich. Man muss ja alles dazu rechnen, also auch Partien.
Die Ergebnisse der Konferenz in Lehrte sind völlig realitätsfremd. Das ist blinder Aktionismus. Schach ist nun einmal ein Ergebnissport. Da muss man auch üben. etwas lernen und sich anstrengen. Das ist dann zunächst einmal keine Wohlfühloase. Und man muss ja ehrlich sein. Wenn man immer verliert, macht es keinen Spaß. Der kommt auch schon mit kleinen Erfolgen. Mit den Erfolgen wächst dann auch das Selbstvertrauen.
Wenn es an der Motivation fehlt, dann ist es nicht die Aufgabe des Trainers auch noch Lob zu verteilen. Bestenfalls weiß das Kind, dass das nicht ehrlich ist. Schlimmer ist noch, wenn der Eindruck entsteht, dass man sich in allen Lebensbereichen einfach durchmogeln kann.
In meiner Jugend galt ja wohl ganz allgemein in Deutschland „Nicht geschimpft, ist genug gelobt“. Wenn ein Kind im Training oder in der Partie Dinge richtig macht, dann gibt es natürlich ein positives Feedback vom Trainer. Fehler werden aber trotzdem angesprochen.
Moin, die jungen deutschen Mädchen haben bei der EM ja vom Ergebnis her wirklich sehr schlecht abgeschnitten. Ich habe mir die übertragenen Partien mal angeschaut. Viele waren es ja nicht, daher habe ich auch mal in die älteren Übertragungen geschaut. Die Eröffnungen spielten die alle ganz passabel, allerdings immer mehr oder weniger dasselbe. Die Vorbereitung durch die deutschen Trainer sieht mir sehr oberflächlich aus. Einem guten Trainer fällt leicht dagegen etwas spezifisch vorbereiten und die Mädchen auf dem falschen Fuß zu erwischen. Die Ausnahme war das Mädchen in der G12, die am Ende vorne gelandet ist. Von der gibt es bei der EM auch ein paar mehr übertragene Partien, wahrscheinlich, weil die im Turnierverlauf weiter oben gespielt hat als die anderen. Ihre Eröffnung ist sehr variabel, d4, e4, c4 mit weiß, mit schwarz verschiedene Sizilianer. Ich habe aber auch Caro-Kann und Nimzo-Indisch in alten Übertragungen gefunden. Die scheint einen besseren Trainer zu haben als die anderen, oder ist einfach ein talentierteres Mädchen, das von sich aus viel ausprobiert.
Lasker hat das Ziel wie folgt defininiert (zit. nach „SchachTraining“, S.258f)t:
“ ‚Nehmen wir den Fall, ein Meister, mit sachlicher Methode ausgestattet, wollte einen beliebigen des Schachspiels unkundigen jungen Mann bis zur Klasse jener Tausend, die keine Vorgabe mehr empfangen, vorwärts bringen, wie viel Zeit würde das benötigen? Zur Beantwortung mache ich die folgende Berechnung:
Spielregeln nebst Übungen 5 Stunden; Elementare Endspiele 5 Stunden; Einige Eröffnungen 10 Stunden; Kombinationen 20 Stunden; Position 40 Stunden; Partienspiel nebst Analysen 120 Stunden.‘
Das erscheint selbst für die Verhältnisse der damaligen Zeit sehr optimistisch. Schachpsychologe und GM Krogius, der das Laskersche Ziel mit dem Erreichen der Leistungsklasse 1 (was etwa DWZ 1800+ entsprechen dürfte) . —“
„Eine von uns angestellte Untersuchung der Biographien von fast hundert Meistern hat ergeben, dass sie den Weg bis zur 1.Leistungsklasse im Durchschnitt in drei Jahren ernsthaften Lernens zurücklegten, wobei sie in dieser Periode nicht 200 Stunden für das Studium von Theorie und Praxis, sondern bedeutend mehr Zeit (das 4-5fache) aufwendeten.“
Zwar war damals das schachliche Wissen noch sehr begrenzt und das Niveau viel niedriger. Dennoch war Lasker sicher viel zu optimistisch.
Krogius Annahme ust dagegen realistisch; folgt der Faustformel von durchschnittlich jeweils 200 Std. für das Erreichen der nächsthöheren Klasse. 1.800 entspricht ungefähr dem Bereich der besten 20% der organisierten Spieler, aber nach 100 Jahren und einer völlig veränderten Schachwelt lässt sich das nicht mehr wirklich quantifizieren. Vorgaben sind ja auch aus der Mode gekommen, was ein bisschen schade ist.
Einem meiner Schüler (Elob 1.480) gab ich in einer Rapidpartie den b-Springer vor, gewann (Taktik!) und bot ihm an, als nächstes einen Turm vorzugeben – unter der Bedingung, ihn im Falle des Verlusts „Rookie“ zu nennen, worauf er sich aber nicht einließ, grins!
Ich bin gegen häufiges und „motivierendes“ Lob, die Kinder merken ohnehin bald, dass das nicht wirklich so gemeint war. Ich lobe selten, und wenn wissen meine Schüler, dass es ernst gemeint ist und sie zu Recht stolz sein können.
Den Schachtrainer von morgen, wie ihn die DSJ sich vorstellt, könnten wir TriTrainer nennen: Schachtrainer, Psychologe und Animateur – drei für den Preis von einem!
Die Eröffnungsvorbereitung wird allgemein überschätzt und ist in der U8w ohnehin kaum möglich. Es gibt wenig, manchmal gar kein Partienmaterial der Gegnerinnen, die oft sehr früh abweichen (normalerweise sehen wir 8-10 Züge Theorie, dort aber oft sehr viel weniger), die Spielerin hat meist nicht die Fähigkeit, eventuell erzielte Vorteile zu nutzen (z.B. in eine positionell günstige Stellung abzuwickeln, oder sich die Variante mit ihren Verzweigungen zu merken) und z.B. bei der DEM u8w allgemein defensiven Aufbau ist es kaum möglich, einen „Schmetterball“ zu landen. Manchmal macht eine Vorbereitung die Spielerin nur nervös bzw. frustriert sie, wenn etwas ganz anderes aufs Brett kommt. Die Arbeit an der Eröffnung muss vor dem Turnier abgeschlossen sein und lediglich bei ausgefallen Eröffnungen wie Orang Utan, Grobs Angriff oder 1.f4 lohnt sich eine besondere Vorbereitung. Diese kommen aber praktisch nie vor.
Petejas Kritik:
„Die Vorbereitung durch die deutschen Trainer sieht mir sehr oberflächlich aus. Einem guten Trainer fällt leicht, dagegen etwas spezifisch vorbereiten und die Mädchen auf dem falschen Fuß zu erwischen.“
ist unberechtigt, ich möchte sehen, wie er das im Bereich DWZ 800-1400 (und auch generell) umsetzen würde.