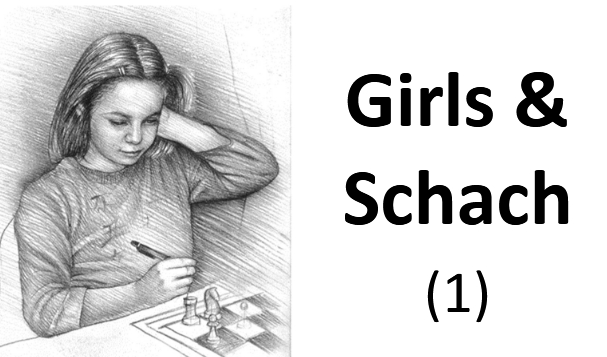
Gerald Hertneck hat zum Artikel „Umfrage für mehr Mädchen und Frauen im Schach“, im Schach.kicker 14.6.2025, der KI die beiden Fragen gestellt (Kommentar 22.6.):
„Gründe für den geringen Anteil von Mädchen und Frauen im organisierten Schachsport“ und „Wie kann das Schachspiel attraktiver für Frauen und Mädchen gestaltet werden?“
Auf die Antworten der KI möchte ich in der Folge in mehreren Beiträgen näher eingehen. Zu Beginn möchte ich klarstellen, dass ich keineswegs negativ eingestellt bin zum Frauenschach oder den Bemühungen, den Mädchen- und Frauenanteil im DSB zu erhöhen. Mit dem Versuch, an Annahmen und Behauptungen zu diesem Themenkomplex analytisch heranzugehen, möchte ich die entsprechenden Bemühungen sogar unterstützen, auch wenn das nicht jede(r) der Aktivisten so sehen wird.
Wir starten mit
Förderung und Einschätzung
Die KI schlußfolgert:
1. Geschlechterstereotype und Vorurteile
– Mädchen und Frauen sehen sich im Schach mit hartnäckigen Vorurteilen konfrontiert, etwa der Annahme, sie hätten … geringeres Potenzial für Brillanz als Jungen und Männer. Diese Vorurteile werden nicht nur von der Gesellschaft, sondern auch von Eltern und Trainern weitergegeben, was das Selbstvertrauen und die Motivation von Mädchen schon früh negativ beeinflusst.
– Solche Stereotype führen dazu, dass Mädchen seltener mit Schach beginnen oder früher wieder aufhören, weil sie sich weniger zugehörig oder gefördert fühlen.
2. Geringere Förderung und Unterstützung
– Studien zeigen, dass Schach spielende Mädchen von Eltern und Trainern oft weniger gefördert werden als Jungen. Das betrifft sowohl die Einschätzung ihres Potenzials als auch die tatsächliche Trainings- und Turnierunterstützung.
***
Hier bezieht sich die KI wohl auf die Studie „Checking Gender Bias: Parents and Mentors Perceive Less Chess Potential in Girl“ der Doktorandin Sophie H. Arnold, New York University 2023. Die Study wird manchmal Jennifer Shahade zugeschrieben, die aber nur eine Mitwirkende war und zudem nicht unbedingt neutral sein mag, da sie Feminismus studiert hat und als Schachprofi und -Autorin zum Thema Frauenschach vom Ergebnis profitieren könnte.
Was gerne vergessen wird ist, dass die Verhältnisse in den USA in vielen Bereichen von denen in Deutschland abweichen, also nicht alle Ergebnisse unbesehen übernommen werden können. So sind z.B. die Spieler nicht Mitglied eines Vereins (den es meist gar nicht gibt), sondern direkt Mitglied des Verbandes, der USCF.
Die Studienautorin gibt zudem ehrlich zu, dass ihre Resultate nur bedingt aussagekräftig sind sowie auch einige andere Defizite aufweist (Zitate jeweils übersetzt von DeepL.com):
„Die Studie umfasste nicht genügend Mütter und weibliche Mentoren, um festzustellen, ob sich ihre Ansichten von denen der Väter und männlichen Mentoren unterschieden. Die Ergebnisse spiegeln möglicherweise auch nicht die Meinung der breiten Öffentlichkeit wider, da die Teilnehmer bereits im Wettkampfschach aktiv waren und umfangreiche Interaktionen mit den von ihnen bewerteten Spielern hatten, was in der Regel Verzerrungen verringert.“
Teilnehmer waren 286 Eltern und Trainer (248 männlich = 90,2%, 25 weiblich, 2 non binär, 11 ohne Angabe), mit insgesamt 654 Kinder, davon 81% Boys.
Das Untersuchungsziel der Studie wird wie folgt erklärt (S.1):
„Hier konzentrieren wir uns auf die Rolle von Eltern und Mentoren (z. B. Schachtrainern) bei der Entstehung von geschlechtsspezifischen Ungleichheiten im Schach. Konkret untersuchen wir mögliche Vorurteile von Eltern und Mentoren gegenüber jungen Spielerinnen, indem wir messen, wie sie diese im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen bewerten und in sie investieren. Zusätzlich untersuchen wir zwei potenzielle Moderatoren dieser Vorurteile:
die Überzeugung, dass man, um ein großartiger Schachspieler zu sein, Schachtalent („Brillanz“) braucht und die Überzeugung, dass Männer im Schach brillanter sind als Frauen. Vorurteile gegenüber jungen Spielerinnen sind möglicherweise bei Eltern und Mentoren, die eine dieser Überzeugungen vertreten, stärker ausgeprägt.“
Ein Teil der Befragung galt der Einschätzung des Potentials (S.4):
„Höchste mögliche US-Schachwertung für jugendliche Spieler. Um die Einschätzung der Eltern und Mentoren zum Potenzial der jugendlichen Spieler zu bewerten, haben wir sie ausdrücklich gebeten, über das „Schachpotenzial” der Spieler nachzudenken und dann gefragt: ‚Angenommen, [Kind/Schützling] spielt weiterhin Schach, was ist Ihrer Meinung nach die höchste US-Schachwertung, die [Kind/Schützling] in seiner Schachkarriere erreichen könnte?‘ ”
Das Ergebnis der Befragung war (S.7):
„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Eltern und Mentoren im Durchschnitt der Meinung waren, dass Mädchen und junge Frauen ein geringeres Schachpotenzial haben als Jungen und junge Männer. Diese Abwertung des Potenzials von Mädchen war besonders ausgeprägt bei Eltern und Mentoren, die der Meinung waren, dass man brillant (Anmerkung: das meint talentiert) sein muss, um gut im Schach zu sein.“
Nun, ist das eine überraschende Erkenntnis? Die Ratinglisten weltweit zeigen, dass Mädchen / Frauen auf allen Ebenen ca. 200 Punkte tiefer liegen als Jungen / Männer und das ihre Werte in Bezug auf den GM-Titel unterproportional sind: Nur 40 Frauen sind unter den 1841 GM (Stand 11/2024), in Deutschland nur 1 Frau (Elisabeth Pähtz) unter ca. 100 GM bei einem Frauenanteil von ca. 10%.
„Zusammenfassend liefert die vorliegende Studie erste Hinweise darauf, dass die wichtigsten Erwachsenen im Leben junger Schachspieler – ihre Eltern und Mentoren – der Meinung sind, dass junge Spielerinnen weniger Potenzial haben als junge Spieler. Diese Voreingenommenheit war besonders ausgeprägt, wenn Eltern und Mentoren glaubten, dass Erfolg im Schach brillante Fähigkeiten (Anmerkung: Talent) erfordert.“ … (S.12)
Auch hier ist das keine Überraschung. Wer würde nicht ein Kind, das ein gutes Talent zeigt, höher einschätzen als ein mit weniger oder keinem besonderen?
Ist eine Einschätzung, die von realen Tatsachen und Erkenntnissen ausgeht, wirklich eine Barriere für die Entwicklung von Mädchen im Schach?
Diese Einschätzung beeinträchtigt auch nicht den Aufwand, der für die Girls getätigt wird, wie die KI fälschlich annimmt (wohl auf der Basis von Meinungen im Internet):
„Die Vorurteile von Eltern und Mentoren gegenüber jungen Spielerinnen könnten sich auch in geringeren Investitionen in diese Spielerinnen (im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen) äußern. Allerdings gaben Eltern und Mentoren nicht an, unterschiedlich in junge Spielerinnen und Spieler zu investieren. (S.12)
Auch einige Aussagen der Studie mögen überraschen (und werden wohl nicht von den „Aktivisten“ zitiert), S.9 (Fettdruck von mir):
„Insgesamt bewerteten die Teilnehmer das Umfeld im Schach nicht als weniger förderlich für weibliche (im Vergleich zu männlichen) jugendliche Spieler (…). Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass die zuvor dokumentierten insgesamt niedrigeren Bewertungen des Schachpotenzials weiblicher (im Vergleich zu männlichen) Spieler wahrscheinlich nicht auf die Wahrnehmung zurückzuführen sind, dass weibliche (im Vergleich zu männlichen) Spieler im Schach mit größeren Hindernissen konfrontiert sind.“
Es gab aber einen Unterschied:
„Die Mentoren bewerteten das Schachumfeld ihrer weiblichen und männlichen Mentees als ähnlich unterstützend.“ …
„Im Gegensatz dazu dachten die Eltern, dass die Schachumgebung für ihre Söhne förderlicher sei.“
Und zum Aufhören mit Schach (S.11):
„Eltern und Mentoren waren nicht der Meinung, dass ein wenig unterstützendes Schachumfeld in unterschiedlichem Maße für den Ausstieg weiblicher gegenüber männlichen jugendlichen Spielern verantwortlich war.“
Die Macher der Studie schlussfolgern:
„… that the discussed research has bought an important scientific insight to the phenomenon of why women and girls are still underrepresented in chess.“
Nun ja, bei solchen Projekten liegt der Erfolg auch zuweilen im Auge des Betrachters. Ob die Einschätzung der Spielstärke / des Potentials durch Eltern / Trainer auf Grundlage durchaus realistischer Werte und Annahmen wirklich etwas mit der Anzahl organisierter weiblicher Schachspielerinnen zu tun hat, mag jeder Leser für sich entscheiden. Es ist aber nicht anzunehmen, dass dies ein wesentlicher Faktor ist.
Tatsächlich widerlegt die Studie ja teilweise die Einschätzung der KI!
Die von der KI aus dieser Studie abgeleiteten „Barrieren“ für die Girls sind m. E. entweder nur gering (und auch Boys haben es ja nicht immer leicht) oder so gut wie nicht existent. Vermutlich hat sich aber auch keiner der Menschen, die zu ähnlichen Aussagen wie die KI gelangt sind oder diese einfach übernommen haben, sich die Mühe gemacht, sich durch die 12 engbedruckten Seiten der Studie (+ Bibliographie) durchzuarbeiten.
Den Artikel stelle ich auch auf Schachfeld.de ein mit einer anhängenden pdf des Textes zum Download.
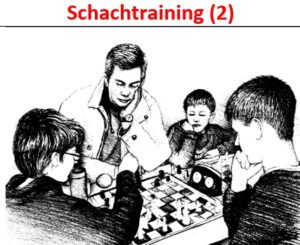
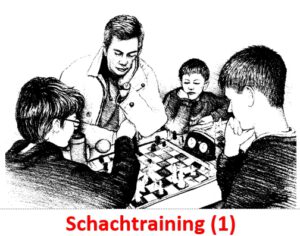
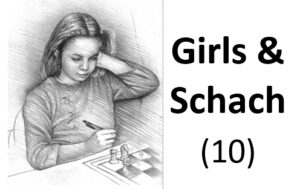
Ich denke, hier muss man an erster Stelle ganz klar darauf hinweisen, dass es im Nachwuchsschach einen sehr gut organisierten Spielbetrieb für Mädchen und für Jungs gibt, was sich ja in allen Altersklassen (U8 bis U20) ausprägt. Insofern haben die Mädchen und jugendlichen Frauen gleichberechtigte Chancen, am Spielbetrieb teilzunehmen. Deshalb ist es in der Tat wahrscheinlich, dass das Phänomen eher an den abgeschwächten Erwartungen und an den Vorurteilen der „Stakeholder“, also der Beteiligten liegt.